
In der Casa Junín arbeiten fünf Menschen, die ihr Kunstprojekt als offenes, mediales Produktionshaus verstehen. Denn auch wenn Agustín Pecile, Nahuel Raiman, Boris Lawler, Octavio Pandolfo und Lucía González de Azcuénaga den Kern des Kollektivs bilden, sind weitaus mehr Menschen an den Projekten beteiligt. In der Casa Junín entstehen kreative Werke; darunter Musik, aber auch Videos und Fotos. Die Leidenschaft für die Kunst hat die Mitglieder an unterschiedlichen Orten und Zeitpunkten zusammengebracht: Teilweise kennen sie sich schon aus der Kindheit, teilweise erst seit wenigen Monaten.
Die Zukunft der Kunst- und Kulturwelt ist unter der Regierung von Milei ungewiss. Klar ist, dass drastische Veränderungen bevorstehen. Mit der Begründung, die extrem hohe Inflation des Landes zu bekämpfen, hat Milei auf seinem Sparkurs unter anderem die Schließung staatlicher Behörden in allen Provinzen Argentiniens und den Rückzug des Staates aus der Finanzierung des Bildungs- und Gesundheitswesens angeordnet. Auch staatliche Universitäten wie die Nationale Universität für Kunst oder die Universität Buenos Aires sollen in Zukunft weniger Fördergelder bekommen. So werden immer weniger junge Menschen ihre Abschlüsse machen können, da sie sich das Studium nicht mehr leisten können. Diese Aussichten beunruhigen die Mitglieder der Casa Junín sehr, denn selbst vor Milei konnten einige von ihnen ihre Abschlüsse wegen fehlender finanzieller Mittel nicht machen. „Wie wird Argentinien sich verändern, wenn es nur noch wenigen wohlhabenden Menschen vorbehalten ist, zu studieren?“, fragt sich beispielsweise Lucía González de Azcuénaga.
Auch verschiedene Kunstinstitutionen stehen auf Mileis Abschussliste, darunter der argentinische Kulturfond, das nationale Theaterinstitut und das INCAA, Institut für Film und audiovisuelle Kunst. Das staatliche Ministerium für Kultur wurde bereits mit Amtsantritt der neuen Regierung am 10. Dezember 2023 auf den Rang eines Sekretariats degradiert. Der Theaterproduzent Leo Cifelli, der das neue Sekretariat anleitet, hat bereits angekündigt, dass das Budget für den Bereich nicht sehr groß sei. Darüber hinaus wurde die Verwendung von gendergerechter Sprache im öffentlichen Dienst verboten. Auch das INADI, Argentiniens Institut gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, wurde aufgelöst. Milei rechtfertigt die Maßnahmen mit anderen Prioritäten: „Wir können nicht so ein Institut betreiben, während Kinder auf der Straße hungern müssen“, so Argentiniens Präsident. Das mag logisch klingen, wäre da nicht Mileis Doppelmoral. So unterschrieb er zur gleichen Zeit ein Dekret, das sein Gehalt um 48 Prozent erhöht. Bei Nahuel Raiman der Casa Junín stoßen Entwicklungen wie diese auf Entsetzen: „Es ist ja verständlich, dass irgendwo gekürzt werden muss. Aber gerade in den Bereichen, die als Sprachrohre für die breite Gesellschaft fungieren? Es sagt doch schon alles, dass er sich trotz Argentiniens prekärer wirtschaftlicher Lage die eigenen Taschen vollmacht.“
Neben den Streichungen für die Universitäten und den Kulturbereich sollen künftig auch öffentliche Fernsehkanäle wie Pakapaka wegfallen. Pakapaka ist ein Kanal für Kinder, der nicht nur Unterhaltung, sondern auch Bildungsinhalte anbietet. In dem Programm gibt es beispielsweise eine Serie, die historische Persönlichkeiten Argentiniens vorstellt. Noch steht der Kanal kostenfrei für alle Bürger*innen zur Verfügung. Doch sollten Fernsehkanäle wie dieser bald wegfallen, dann geht Argentiniens Medienvielfalt auch im TV-Bereich verloren. Übrig bleiben Kanäle im Besitz privater Unternehmen und damit einer kleinen Gruppe von Menschen, die ähnliche Ansichten teilen und zu den Privilegiertesten des Landes gehören. Eine unabhängige Fernsehlandschaft wird damit unwahrscheinlicher.
Wenig Raum für Optimismus
Doch es werden nicht nur Menschen aus dem Kunst- und Kulturbereich den Preis für Mileis Maßnahmen zahlen müssen. Am Ende leiden alle Argentinier*innen unter den Kürzungen im Namen der Sparpolitik. Denn sobald kein Geld mehr in Kultur und öffentliche Bildungsarbeit investiert wird, fällt diese kulturelle Bildung in die Eigenverantwortung der Menschen. Die Kürzungen werden zwar auch den kulturellen Betrieb in der Metropole Buenos Aires stark verändern und beeinträchtigen, jedoch bleiben dort zahlreiche Möglichkeiten für die Stadtbewohner*innen, sich miteinander auszutauschen und zu vernetzen. Ganz anders sieht es in den ländlichen Regionen aus. Dort gibt es von vornherein deutlich weniger Angebote. Dazu kommt die erschwerte Vernetzung über weite Distanzen, die eine Kollektivierung, zumindest außerhalb der virtuellen Welt nicht leicht macht. „Solche Ausblicke lassen wenig Raum für Optimismus“, meint Agustín Pecile, denn „Kultur ist Geschichte und Identität; jene Dinge, die ein Land ausmachen, die es einzigartig machen. Ohne all das ist die ganze nationale Identität in Gefahr.“

Gefahr ist auch auf den Straßen Argentiniens deutlich zu spüren. Bei vielen friedlichen Demonstrationen und Kundgebungen kommt es immer öfter auch zu gewaltvollen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstrant*innen. Wie auch bei einem Protest vor wenigen Wochen, der vor dem Kino Gaumont in Buenos Aires stattfand. Er richtete sich gegen die Definanzierung des Instituts für audiovisuelle Kunst und Kino, das das Kino betreibt. Die Polizei setzte Tränengas gegen die protestierenden Kulturschaffenden und Studierenden ein, um den Protest aufzulösen. Wie schon so oft drohte das Sicherheitsministerium zudem damit, denjenigen, die an den Protesten teilnehmen, die Sozialleistungen zu streichen. Die Protestierenden sehen das als Form der Erpressung und des Missbrauchs.
Was dem Kollektiv der Casa Junín jedoch am meisten Angst macht, ist nicht der Präsident selbst, sondern die Menge an Menschen, die hinter seinen Maßnahmen stehen und ihn in seinen Vorhaben unterstützen. Bei Lucía González macht sich das Gefühl breit, dass „viele der Bürger*innen Argentiniens genug davon haben, Bürger*innen Argentiniens zu sein. Wenn sie lieber Milei zujubeln, während er stolz herumposaunt, wie er die Kultur unseres Landes zerstören wird, und damit prahlt, Argentinien zu den nächsten USA oder dem nächsten Deutschland machen zu wollen, dann stimmt das einen schon sehr nachdenklich.“
Wie die Zukunft der Kultur in Argentinien aussieht, bleibt ungewiss. Für die Filmwelt ist weiterhin mit Bewegtbild aus Argentinien zu rechnen – jedoch nicht immer aus eigener Produktion, meinen die Künstler*innen von der Casa Junín. Oft kämen ausländische Filmproduktionen aus der ganzen Welt nach Argentinien, um dort in der Natur zu drehen. Denn das Land bietet mit mehreren Klimazonen und diversen Landschaften – von subtropischen Wäldern und Graslandschaften bis hin zu Gletschern – viele verschiedenen Kulissen. Dies sei nicht nur attraktiv für großen Filmproduktionen. Auch der Staat verdient daran mit. Um die eigenen Filme steht es jedoch kritischer. Viele Argentinier*innen konnten sich vor Mileis Regierungszeit an Instituten wie das INCAA wenden und dort Förderungen für ihre Ideen beantragen. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Die Casa Junín schlussfolgert: „Kino und Kunst werden bald von Leuten bestimmt werden, die die finanziellen Mittel dazu haben. Durch die Kürzungen versucht man, die Menschen, die diese Mittel nicht haben, zum Schweigen zu bringen.“

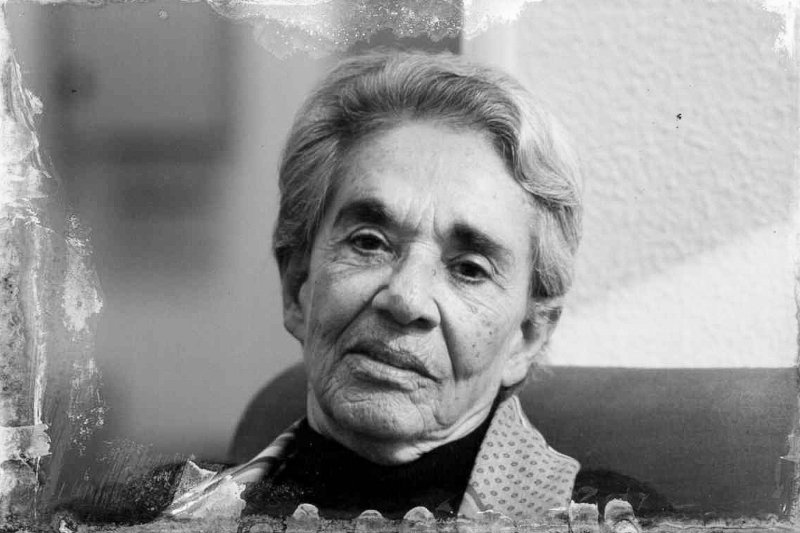





 Was macht Antena Negra aus?
Was macht Antena Negra aus?