Purpurne Lichter. Ein tanzendes Paar auf einer großen Elektroparty. Der Text der Musik deutet eine christliche Botschaft an. Sie hebt die Hände und denkt an einen gemeinsamen Traum. So beginnt Divino Amor (Göttliche Liebe), der uns die Geschichte von Joana und Danilo erzählt, einem brasilianischen Paar mittleren Alters. Joana arbeitet im Standesamt und hilft ihren Nächsten dort auf ganz persönliche Weise, Danilo stellt Blumengestecke für Beerdigungen her. Sie verstehen sich sehr gut und lieben sich, aber etwas fehlt ihnen noch, um sich richtig glücklich zu fühlen: ein Kind.
Begeistert und ohne Ruhepausen nehmen sie auf dem Weg zu ihrem großen Ziel an allen möglichen schulmedizinischen, alternativen und religiösen Behandlungen teil. Sie selbst sind eifrige Anhänger und ehrenamtliche Mitarbeiter einer religiösen Sekte, die sich der Lösung von Eheproblemen widmet. Allein für das Betreten der Räumlichkeiten ist eine Hochzeitsurkunde Bedingung. Joana wirbt neue Ehepaare mit Problemen an; da sie praktischerweise beim Standesamt für Scheidungen zuständig ist, kann sie die Rekrutierungsgespräche für ihre Kirche direkt im Büro führen. Interessierte Paare nimmt sie zu Gesprächskreisen mit. Dort schütten sie ihr dann ihr Herz aus, beten gemeinsam, lesen aus der Bibel und finden wieder zueinander.
 Foto: © Desvia
Foto: © Desvia
Die Geschichte entwickelt sich zunächst langsam und erwartungsgemäß – bis zur ersten Taufe der neuen Sektenmitglieder: Ein Paar badet das andere und sie liebkosen sich gegenseitig bis hin zu einem unerwarteten Ende: die Kirche wird unvermittelt zum Swingerclub. Schweigen und Überraschung im Kinosaal.
Nach weiteren Szenen inniger Gebete und einigen (unnötig langen) Sexszenen am Rande des Softpornos beantwortet sich schließlich die zentrale Frage: Joana wird schwanger. Nur – von wem?
Die schauspielerischen Leistungen in Divino Amor überzeugen, insbesondere die von Dira Paes, die uns als Joana die Kraft und Überzeugung hinter ihrem großen Traum mit enormer Ausdruckskraft nahebringt. Das Drehbuch erlaubt den Schauspieler*innen, die Figuren mit Leben zu füllen und erzählt die kontroverse und gleichzeitig etwas verrückte Geschichte mit einfachen Mitteln, ohne nenennswert ins Karikaturenhafte oder Vulgäre abzugleiten. Regisseur Gabriel Mascaro hat ein interessantes Werk geschaffen, das sich in sauberen Einstellungen voller futuristischer Grüntöne und Neonpurpur mit Weltanschauungen, radikaler Selbstüberzeugung und religiöser Indoktrinierung beschäftigt.
AUF DER SUCHE NACH DER BLAUEN BLUME
Komm doch näher! Willst du Kaffee?“ fragt Marcelo und meint damit den Kameramann. Kurze Zeit später filmt dieser ihn von der gegenüberliegenden Seite des Tisches. Die Zuschauer*innen können Marcelo beim Frühstück genau beobachten, die Kamera scheint dabei für ihn kein störendes Element zu sein. Bewusstkommuniziert und spielt mit ihr. Schon in den ersten Szenen von A rosa azul de Novalis wird deutlich, dass es sich hier um keinen gewöhnlichen Dokumentarfilm handelt. Als „dokumentarische Inszenierung“ bezeichnen die jungen brasilianischen Filmemacher Gustavo Vinagre und Rodrigo Carneiro ihr Projekt, das den 40-jährigen Marcelo Diorio in seiner Wohnung in São Paulo (die sich im Übrigen überall auf der Welt befinden könnte) beobachtet.
Der Film, der im diesjährigen Berlinale Forum zu sehen ist, folgt Marcelo in seinem normalen Tagesablauf – Frühstück, Lesen, Pflanzenpflege, Online-Dating – unterbrochen von Sequenzen, in denen er aus seinem Leben erzählt oder in traumartigen Szenen in die Vergangenheit zurückkehrt. Seine zu Beginn betonte HIV-Diagnose verliert im Laufe des Films an Bedeutung und scheint auch für ihn keine große Sache zu sein. Er bezeichnet die ihm schon jahrelang bekannte Erkrankung als seine „kalkulierte Tragödie“ und weiß, dass er nicht an ihr sterben wird.
Stattdessen sind in seiner Welt bestimmte Rituale wichtiger. Da ist etwa die spezielle und ausgiebige Pflege seines Körpers und vor allem das Lesen – wie viele der Forumsfilme in diesem Jahr hat auch A rosa azul de Novalis einen starken Bezug zu geschriebenen Texten. Die Bücher in seinem Haus sind Marcelos Schätze, gehören genauso zu seinem Tagesablauf wie das Kaffeekochen oder die Gesichtsmaske und durchziehen seine Träume. Vor allem Novalis und seine blaue Blume haben es ihm angetan, ein Porträt des deutschen Frühromantikers schmückt seinen Treppenaufgang. Die Frage nach Marcelos eigentlichem Beruf wird im Film mehrmals gestellt, jedoch immer wieder verworfen: Marcelo lebt durch seine zelebrierten Rituale. Sie füllen seinen Tag und sein Leben, eine andere Arbeit braucht er nicht.
Neben Alltäglichkeiten erfahren Zuschauende viel über die Vergangenheit des Protagonisten. Die besondere Beziehung zu seinem verstorbenen Bruder, die Erinnerungen an seine Eltern und deren Nichtakzeptanz seiner Homosexualität, seine kühnsten Fantasien und Traumata aus Kindheitstagen, alles ist präsent und wird auf besondere Art und Weise von Gustavo Vinagre und Rodrigo Carneiro verbildlicht. Durch die Form der dokumentarischen Inszenierung wird der Film zu einer ergebnisoffene Suche nach Möglichkeiten, wie ein einzelnes Leben beschrieben und verstanden werden kann. Marcelo, der selbst an der Entstehung des Drehbuchs beteiligt war, macht sich die gleichen Gedanken und begibt sich frei nach Novalis‘ Vorbild auf die Suche nach seiner eigenen blauen Blume. Offen und ehrlich lässt er sich und seine sexuelle Begegnung von der Kamera beobachten. So entsteht eine 70-minütige, für manch eine*n sicher gewöhnungsbedürftige, Suche nach der blauen Blume, die so manch ungeahnten Einblick ermöglicht.
DER HERR DER FLIEGEN IN KOLUMBIEN
Kein Flugzeugabsturz, keine einsame Insel und keine europäischen Schulknaben. Und doch tobt die grinsende Schweinefratze, der „Herr der Fliegen“ wie man ihn aus William Goldings gleichnamigen Roman kennt, eindringlich durch Monos, den neuen Film des ecuadorianisch-kolumbianischen Regisseurs Alejandro Landes, der dieses Jahr im Berlinale Panorama zu sehen ist. Monos“, so nennt sich die achtköpfige Gruppe von jungen Gueriller@s, die in den kolumbianischen Anden ausharrt. In der Abgeschiedenheit der Berge sollen die etwa 12- bis 16-Jährigen bewaffnet und auf sich gestellt eine nordamerikanische Geisel und eine Milchkuh bewachen. Kontakt zu Befehlshaber*innen haben sie nur über ein Funkgerät. Zu welcher Guerilla-Organisation gehören sie? Und warum unterstützt kein Erwachsener die Jugendlichen bei der herausfordernden Aufgabe?
 Auf den ersten Blick wirken die „Monos“ weniger wie Aufständische, sondern mehr wie gewöhnliche, überdrehte Teenager auf einer Klassenfahrt mit zugegeben hippieskem Charme: Umgeben von Bergspitzen und klarer Luft toben die Jugendlichen frei durch die Natur, sitzen gemeinsam am Feuer, erzählen, lachen und entwickeln ihre ersten romantischen Gefühle. Sehr eindrucksvoll sind auch ihre ausgelassenen Tänze und bunten Gesichtsbemalungen. Jedoch werden die vermeintlich idyllischen Szenen durchbrochen durch die harten Militärübungen der Kinder und die untereinander herrschende Hierarchie. Zum Spaß schießen die „Monos“ mit ihren Waffen wild in die Luft und sind ihrem Anführer „Lobo“ (Wolf) treu ergeben. Es lässt sich also nichts Gutes ahnen, als die Jugendlichen eines Morgens bewaffnet und schreiend einen ihrer Kameraden verfolgen, bis dieser ins Gras fällt. Sie geben ihm heftige Schläge auf das Hinterteil, während sie laut mitzählen. Erst beim 15. Schlag rufen sie dem am Boden Liegenden plötzlich lachend zu: („Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!“)
Auf den ersten Blick wirken die „Monos“ weniger wie Aufständische, sondern mehr wie gewöhnliche, überdrehte Teenager auf einer Klassenfahrt mit zugegeben hippieskem Charme: Umgeben von Bergspitzen und klarer Luft toben die Jugendlichen frei durch die Natur, sitzen gemeinsam am Feuer, erzählen, lachen und entwickeln ihre ersten romantischen Gefühle. Sehr eindrucksvoll sind auch ihre ausgelassenen Tänze und bunten Gesichtsbemalungen. Jedoch werden die vermeintlich idyllischen Szenen durchbrochen durch die harten Militärübungen der Kinder und die untereinander herrschende Hierarchie. Zum Spaß schießen die „Monos“ mit ihren Waffen wild in die Luft und sind ihrem Anführer „Lobo“ (Wolf) treu ergeben. Es lässt sich also nichts Gutes ahnen, als die Jugendlichen eines Morgens bewaffnet und schreiend einen ihrer Kameraden verfolgen, bis dieser ins Gras fällt. Sie geben ihm heftige Schläge auf das Hinterteil, während sie laut mitzählen. Erst beim 15. Schlag rufen sie dem am Boden Liegenden plötzlich lachend zu: („Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!“)
 Ein deutliches Aufatmen geht nach dieser Szene durch den Kinosaal, welches jedoch nicht lange anhält, denn der Film nimmt schnell eine sogartige Spannung an, als die Jugendlichen in ernsthafte Schwierigkeiten geraten und die Situation eskaliert. Letztlich spielt es keine Rolle, zu welcher Organisation die „Monos“ gehören oder welchen Zweck ihre Aktion hat: Mit starker und gewollter Referenz zum Herr der Fliegenlegt der Film seinen Fokus auf ihre Gruppendynamik in der eskalierenden Gewalt. Die unübersehbare Ähnlichkeit zum berühmten Roman nimmt Monos jedoch keinesfalls seine Spannung. Vielmehr kommen in dieser neuen Interpretation weitere interessante Faktoren hinzu, zum Beispiel das Machtverhältnis zwischen den Jugendlichen und der etwa 40-jährigen Gefangenen sowie sexuelle Spannungen. Außerdem treffen häufige Kritikpunkte am Herr der Fliegen – beispielsweise die rassistische Darstellung von Wildheit oder der komplette Verzicht auf Mädchen in der Geschichte – wohl kaum mehr zu auf diese gemischte und vielfältige Gruppe von Jugendlichen aus Lateinamerika in Monos. Alejandro Landes schafft es, mit seinem Film eine eigene Art der Geschichte zu finden und die Zuschauer*innen mitzureißen auf eine wilde, bildgewaltige und spannende Fahrt, die sie atemlos zurücklässt.
Ein deutliches Aufatmen geht nach dieser Szene durch den Kinosaal, welches jedoch nicht lange anhält, denn der Film nimmt schnell eine sogartige Spannung an, als die Jugendlichen in ernsthafte Schwierigkeiten geraten und die Situation eskaliert. Letztlich spielt es keine Rolle, zu welcher Organisation die „Monos“ gehören oder welchen Zweck ihre Aktion hat: Mit starker und gewollter Referenz zum Herr der Fliegenlegt der Film seinen Fokus auf ihre Gruppendynamik in der eskalierenden Gewalt. Die unübersehbare Ähnlichkeit zum berühmten Roman nimmt Monos jedoch keinesfalls seine Spannung. Vielmehr kommen in dieser neuen Interpretation weitere interessante Faktoren hinzu, zum Beispiel das Machtverhältnis zwischen den Jugendlichen und der etwa 40-jährigen Gefangenen sowie sexuelle Spannungen. Außerdem treffen häufige Kritikpunkte am Herr der Fliegen – beispielsweise die rassistische Darstellung von Wildheit oder der komplette Verzicht auf Mädchen in der Geschichte – wohl kaum mehr zu auf diese gemischte und vielfältige Gruppe von Jugendlichen aus Lateinamerika in Monos. Alejandro Landes schafft es, mit seinem Film eine eigene Art der Geschichte zu finden und die Zuschauer*innen mitzureißen auf eine wilde, bildgewaltige und spannende Fahrt, die sie atemlos zurücklässt.
ILLEGALER CHAMPION
Seit Monaten himmelt er die Nachbarin, die er „Chica” nennt, von Weitem an, auf eine pathosbeladene Weise, die dem jungen Werther in nichts nachsteht. Als er sieht, dass sie belästigt wird, schlägt der junge Ich-Erzähler in Aura Xilonens Debütroman Gringo Champ die Täter zusammen und setzt dadurch eine Kette von Ereignissen in Gang, mit der er nie gerechnet hätte: Die Buchhandlung, in der er arbeitet, wird verwüstet und er muss untertauchen – der Protagonist lebt illegal in dieser namen- und gesichtslosen US-amerikanischen Grenzstadt. Dem Protagonisten eines modernen Schelmenromans gleich vagabundiert er durch die Straßen und begegnet dabei (und prügelt sich mit) allerlei merkwürdigen Gestalten.
Seine „Chica“, die er endlich kennenlernt, ist eine der ersten Figuren im Roman, die bei ihrem Namen – Aireen – genannt wird. Die anderen werden, wie er selbst, meist mit Beleidigungen oder ihrer Funktion betitelt, denn: „Auf der Straße ist alles unspezifisch … weil alles sich gleicht, scheiß globalisierte Namen.“ Doch jetzt tut sich etwas im Leben des bis dato namenlosen Protagonisten, nicht nur durch Aireen, sondern auch dank anderer Menschen, die ihm unverhoffte Chancen geben. Je mehr es ihm gelingt, sich in die Gesellschaft zu integrieren, je mehr er wahrgenommen wird und Freunde findet, desto mehr wird er zu Liborio.
Eine wichtige Rolle spielt auch Liborios Vergangenheit: In Rückblenden wird von seinem Leben in Mexiko erzählt, das voller Gewalt und Demütigungen war. Elternlos und von der Patentante verstoßen lebte er auf der Straße, bis er beschloss, sich auf die gefährliche Flucht über den Río Bravo zu machen.Während weder Figuren noch Handlung von Gringo Champ aufsehenerregend sind – der Plot ist recht konventionell und hat, vor allem gegen Ende, einige Längen – so ist es Aura Xilonens Sprache umso mehr. Da trifft starke Umgangssprache auf bildungssprachliches Register, Liborios Straßenslang auf Begriffe, die er durch seine Lektüre von Autoren wie Borges, Homer und Cervantes aufgesogen hat, Englisch auf mexikanisches Spanisch. Das Ganze ist gespickt mit ungewöhnlichen Bildern, die die Leser*innen aus eingefahrenen Lesegewohnheiten herausreißen. All dies hat Susanne Lange virtuos ins Deutsche übertragen, allein die vielen englischen Begriffe, die im Deutschen künstlicher wirken als im spanischen Original, stören ein wenig. Davon abgesehen beweist die kongeniale Übersetzung das fast schon unheimliche, brillante Können von Aura Xilonen, Sprache zu formen und den Worten damit neue Ebenen zu verleihen, vergleichbar mit Werken der Weltliteratur wie Clockwork Orange. Das Überraschendste aber ist Xilonens Alter: Als Gringo Champ 2015 im Original veröffentlicht wurde, war sie gerade einmal 19 Jahre alt.
Im selben Jahr wurde die Autorin und Filmemacherin die erste Preisträgerin des Premio Mauricio Achar, den man ins Leben gerufen hatte, um junge mexikanische Stimmen zu fördern. Auch wenn Gringo Champ nicht perfekt ist, so hat Xilonen alle Aussichten, eine der bedeutenden literarischen Stimmen Lateinamerikas der nächsten Jahrzehnte zu werden.
Aura Xilonen // Gringo Champ // Hanser Literaturverlage // 2019 // 23 Euro // 352 Seiten // Übersetzung von Susanne Lange
EXILIERTE GEDANKEN
Faschismus in Europa, ein autoritäres Regime in Brasilien, Widerstand, Flucht und wechselndes Exil – der Roman „Das Vermächtnis der Seidenraupen“ des brasilianischen Autors Rafael Cardoso ist brandaktuell, obwohl er sich einem historischen Thema widmet. Als Cardoso 23 Jahre alt war, starben im Abstand von nur einem Monat sein Vater und seine Großtante. Der junge Student der Kunstgeschichte räumt daraufhin das Haus seiner Großeltern in São Paulo aus und findet einen „wahren Schatz an Fotografien, Briefen und anderen historischen Dokumenten”. Denn Cardosos Urgroßvater war Hugo Simon, der „rote Bankier“, 1918 für kurze Zeit Finanzminister im Preußischen Revolutionskabinett und einer der wenigen Unterstützer der Friedensbewegung während des ersten Weltkrieges. In seiner Berliner Zeit ist Simon nicht nur ein bedeutender Sammler und Mäzen moderner Kunst und Literatur, in seinem Haus treffen sich auch die fortschrittlichen Geister der Weimarer Zeit, darunter Albert Einstein, Alfred Döblin, Georg Grosz und Renée Sintenis. Neben politischen Aktivitäten betreibt er auch ein landwirtschaftliches Mustergut in Seelow als Versuch einer gelebten Utopie – eine Erfahrung, die für ihn im Exil in Brasilien besonders nützlich sein wird. Cardosos Roman ist somit sowohl persönliche Familiengeschichte als auch historisches Dokument.
Er zeichnet nach, wie Simon, der sich als aufgeklärter, deutscher Intellektueller versteht und seine Religion nicht praktiziert, von den Nationalsozialisten gemäß der „Ariergesetzgebung“ ausgebürgert und sein gesamter Besitz konfisziert wird. Im März 1933, gerade noch rechtzeitig vor dem Einzug ihrer Pässe, begeben er, seine Frau, seine beiden Töchter und sein Schwiegersohn sich ins Exil nach Frankreich. Acht Jahre später fliehen sie, mangels anderer Alternativen, nach Brasilien unter Präsident Getúlio Vargas; Hugo Simon und seine Frau Gertrud mit gefälschten tschechischen Papieren, der Rest der Familie mit einer französischen Identität, die ihnen die Résistance verschafft hat. Das hat schwerwiegende Folgen: Die „noms de guerre“ und das jahrelange Versteckspiel vor nationalsozialistischen Spitzeln und brasilianischen Sympathisanten der Faschisten, belegt die deutsch-jüdische Herkunft mit einem Tabu. Rafael Cardoso selbst erfährt erst mit sechzehn Jahren – nach dem Tod seines Großvaters – von seiner Herkunft. Über die Vergangenheit wird in der Familie nicht gesprochen, die Rückgewinnung der deutschen Identität ist schwierig und Hugo Simon stirbt 1950 im Exil, ohne nach Europa zurückgekehrt zu sein.
Vielleicht auch deshalb wartet Cardoso viele Jahre, bevor er den 1987 entdeckten Familienschatz hebt. Doch nachdem er diese Schwelle schließlich überschritten hatte, muss sich Cardoso lange in diesem (Zeit-)Raum aufgehalten haben. Zu den großen Qualitäten des Romans gehören die vielen, gut recherchierten Einzelheiten des Zeitgeschehens zwischen 1933 und 1945. Der Autor erzählt die Familiengeschichte aus stetig wechselnden Perspektiven der einzelnen Familienmitglieder in Kapiteln, zwischen denen jeweils ein Jahr liegt. Auch wenn vor allem Hugo Simon zu Wort kommt, werden wichtige Ereignisse ebenso von der minderjährigen Tochter Annette erzählt, wie von dem Künstler und Schwiegersohn Wolf Demeter. So setzt sich aus vielen Schlaglichtern ein ganzes Panorama dessen zusammen, was Exil persönlich, künstlerisch und politisch bedeuten kann. Das macht das „Vermächtnis der Seidenraupen“ nicht nur historisch, sondern auch literarisch spannend. Nicht zuletzt erinnert der Roman an die – aus der öffentlichen Diskussion zunehmend ausgeblendete – Notwendigkeit der Flucht aus Europa vor nur zwei Generationen. Eine Notwendigkeit, die angesichts der aktuellen Entwicklungen in Brasilien auch dort bald wieder aktuell sein könnte.
BILDGEWALTIGES MEISTERWERK
Ab Anfang April in den deutschen Kinos Traumafte Schönheit und brutale Realität in Birds of Passage
Es gibt Filme, die erzählen eine Geschichte und es gibt Filme, die machen diese Geschichte erlebbar. Das neue Werk von Ciro Guerra und Cristina Gallego ist einer dieser Filme. Birds of Passage spielt in den 70er Jahren in der Region La Guajira, im Nordosten Kolumbiens, und gilt als der Bonanza Marimbera genannte Ursprung des kolumbianischen Drogenhandels. Rapayet, ein Angehöriger der matriarchalisch geprägten Wayuu, verkauft Marihuana an US-Amerikaner*innen. Der Handel boomt und sorgt für großen Reichtum. Doch die damit verbundene Gewalt zerstört letztendlich seine Familie.
Das Regie- und Produktionsduo aus Ciro Guerra und Cristina Gallego, die schon für Die Reisen des Windes und Der Schamane und die Schlange zusammengearbeitet haben, entführt uns auch diesmal in eine Welt zwischen Legende, Traum und Wirklichkeit. In langen Aufnahmen lassen sie die beeindruckende Wüstenlandschaft der Region auf die Zuschauenden wirken. Die schlichte Rauheit der Natur steht in teils krassem Gegensatz zu der detailreich verzierten, glänzenden Kleidung der Frauen. Ebenso das prunkvolle Haus, das die Familie bewohnt, nachdem der Reichtum Einzug gehalten hat: Es scheint wie ein Geisterpalast in der Weite der Wüste und zugleich protzig und angreifbar – ein Sinnbild des Drogenreichtums. Die Ausdrucksstärke der Bildsprache zeigt sich auch in den stilleren Momenten, deren Symbolgehalt sich auf die Tierwelt bezieht. So verkünden bunt gemusterte, riesig anmutende Heuschrecken kommendes Übel und Plagen, ein nächtlich wiederkehrender schwarzer Vogel versinnbildlicht die unheilvolle Gegenwart eines getöteten Freundes. Auch die reale Gestaltung der Traumbilder, in denen die Matriarchin Úrsula Botschaften für die Zukunft liest, lassen diese als gleichberechtigte Informationsquelle neben den alltäglichen Geschehnissen wahrnehmen. Hier kommt man nicht umhin, den magischen Realismus am Werk zu spüren. Auch in der Erzählweise nähern sich die Regisseur*innen anderen Traditionen an. Ein alter Wayuu besingt in der Eröffnungs- und Schlusssequenz die Geschichte des Films und hebt sie somit in eine orale Tradition, die sich im Handlungsaufbau weiterführt, der thematisch und chronologisch in fünf Gesänge (cantos) unterteilt ist. Dies wird noch unterstrichen, indem fast nur Wayuunaiki, die Sprache der Wayuu, gesprochen wird.
Brüche der Figuren, in denen die traditionelle matriarchale Gesellschaftsstruktur zu bröckeln scheint und sich Rapayet gegen Úrsulas Wort stellt, bringen die Welt einer indigenen Gemeinschaft, die in den Drogenhandel verwickelt ist, näher. Guerra und Gallego ist es gelungen, den Blick auf das bekannte Thema des Drogenhandels in Kolumbien durch eine neue Perspektive und in einer neuen Ästhetik zu betrachten. Auch ist dies der erste Film, in dem Cristina Gallego die Co-Regie übernommen hat, was die starke Frauenrolle im Film betont. Ein überwältigender Film, dessen poetische und surreale Bilder die Zuschauer*innen nicht loslassen und dessen Geschichte Kolumbien noch immer begleitet.
MUSIKLEGENDE UND MEISTER DES VERSCHWINDENS
Suchend fährt die Kamera durch ein Hotel. Entlang an verwaisten Fluren, geschlossenen Türen . Lebt hinter einer von ihnen, vor der Öffentlichkeit verborgen, der Erfinder des Bossa Nova, João Gilberto? Oder bleibt die Suche wie so oft vergeblich? Der Regisseur Georges Gachot begibt sich in seinem Dokumentarfilm Wo bist du, João Gilberto? auf die Suche nach dieser brasilianischen Musiklegende.
Sein Film basiert auf dem Buch Hobálálá, geschrieben von Marc Fischer, einem deutschen Journalisten, dessen Leidenschaft für den Bossa Nova dieses literarische Kunstwerk hervorgebracht hat, betitelt nach dem gleichnamigen Song von Gilbertos erster Platte Chega de Saudade. Auch Fischer war ein Suchender, auch er von der Idee besessen, den Meister zu finden, der 1958 nur mit seiner Gitarre und seiner Stimme einen neuen Musikstil erschuf. Fischers Buch dient dem Filmemacher gewissermaßen als Drehbuch. Es beschreibt die vergebliche Suche nach João Gilberto, einem lebend Verschollenen, der sich allen Versuchen, ihm nahe zu kommen, mit Finesse entzieht. Diese Suche, von Fischer begonnen, nimmt Georges Gachot in seinem Film wieder auf. Dabei dienen ihm Aufzeichnungen, Tagebucheinträge, Fotos, sowie Bild- und Tonmaterial aus dessen Nachlass, denn Marc Fischer hat sich mit gerade 40 Jahren das Leben genommen. Unterstützung für sein Vorhaben findet er bei Rachel Balassiano, die seinerzeit schon Fischers Gehilfin bei der Suche nach João Gilberto war. Gemeinsam gehen sie den in Fischers Buch gelegten Spuren nach. Gachot kontaktiert einstige Weggefährten, Musiker und Komponisten, die ihn zwar zu den Ursprüngen und Wegbereitern des Bossa Nova führen, jedoch nicht zu João Gilberto, denn seine Gesprächspartner*innen haben ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Regisseur und Buchautor verbindet die Sehnsucht nach dem Erlebnis eines schwer zu fassenden, traurigen Verlangens, das in den sanften Klängen, dem schwebenden, fast geflüsterten, poetischen Gesang ihres Idols seinen Ausdruck findet und den Zauber des Bossa Nova ausmacht. Sehnsucht ist im Film ein Schlüsselbegriff, der die Suche nach jenem Unsichtbaren antreibt, der der Welt diese einfühlsame, melancholische Musik geschenkt hat.
Am Ende des Buches fragt Sherlock (das literarische Alter Ego Marc Fischers) seine Gehilfin Dr. Watson (Rachel Balassiano): „Warum haben wir ihn nicht gefasst, Watson? Wir haben doch alles versucht.“ Watson: „Weil die Sehnsucht nicht zu fassen ist. Von niemandem, Sherlock.“ Am Ende des Films ein letzter Versuch des Filmemachers ihn doch noch zu fassen und Gilberto wenigstens ein einziges Mal live spielen zu hören: Vermittelt durch dessen Agenten lauscht Georges Gachot in einer der letzten Einstellungen andächtig seiner Musik durch eine Tür. Bleibt Joao auch diesmal ein Phantom? Das Archivmaterial diverser Konzerte Gilbertos, filmische Streifzüge durch Rio de Janeiro und die allgegenwärtige Präsenz der Bossa Nova-Rhythmen, lassen die Zuschauer*innen die Schönheit dieser Musik erleben. Nebenbei erfährt man, dass der Bossa Nova in der Toilette entstand, da João Gilberto diesen fünf Quadratmeter großen Ort als idealen Resonanzraum erkannte, wo die Akustik am besten war. Der Film ist gleichzeitig eine Art Entdeckungsreise in die Welt der brasilianischen Musik und der brasilianischen Musikszene des Bossa Nova.
DAS VERSCHWINDEN DES JOSEF MENGELE
Olivier Guez weiß, wovon er spricht: Seit mehr als zehn Jahren recherchiert der französische Autor über das Schicksal der Nazis in der Nachkriegszeit. Als Co-Autor des Drehbuchs zu „Der Staat gegen Fritz Bauer“ über die Suche nach Adolf Eichmann bekam er 2016 den Deutschen Filmpreis, im Jahr 2007 erschien sein Buch über jüdische Holocaust-Überlebende in Deutschland. In Das Verschwinden des Josef Mengele dreht es sich diesmal um die Perspektive der Täter.
Lückenlos beschreibt Guez die Flucht Mengeles nach Argentinien im Jahr 1949, seinen jahrelangen Aufenthalt unter falschem Namen im Buenos Aires der 50er Jahre, seine Verstecke in Paraguay und letztendlich in Brasilien. Der Autor gibt Einblicke in die argentinische „Nazi Society“, die sich nach ihren Uniformen zurücksehnt und das wahre Ausmaß der Ermordung der Juden verleugnet. Vom Perón-Regime unterstützt, von der jungen Bundesrepublik zunächst nicht verfolgt, führen die Ex-Nazi-Funktionäre ein ausschweifendes, unbehelligtes Leben. Mengele traut sich nach einigen Jahren sogar, einen deutschen Reisepass auf seinen richtigen Namen anzufordern – und erhält ihn problemlos. Erst nach 1959, als ein deutscher Haftbefehl gegen Mengele erlassen wird, erfolgt die schrittweise Verwandlung Mengeles vom üppig lebenden „Pascha“ zur verfolgten, paranoiden „Ratte“. Seine Flucht über den südamerikanischen Kontinent dauert am Ende dreißig Jahre.
„Das Verschwinden des Josef Mengele“ ist ein Roman. Die Sprache ist durchgehend dokumentarisch-nüchtern, die Erzählung chronologisch. Politische und gesellschaftliche Zusatzinformationen rahmen die Geschichte ein. Der Autor stellt sich vor, dass das Buch wie ein Krimi zu lesen ist. Dabei steht dem/r Leser*in jedoch die Erzählweise im Weg: Die aneinandergereihten Daten und Fakten verhindern an vielen Stellen einen Spannungsaufbau. Die wenigen Gedankenmonologe des Protagonisten reichen nicht aus, um das abstrakte Monster Mengele menschlicher oder verständlicher erscheinen zu lassen. Der ehemalige KZ-Arzt bleibt ein bestialischer Mann, der am Ende seine Strafe erhält, wenn auch keine gerichtliche: Die „Tortur des Exils“ in einem „Gefängnis unter freiem Himmel“. Guez behauptet, fast nichts erfunden zu haben. Ist der Roman dann überhaupt eine Fiktion? Die beiden Berufe von Guez, Journalist und Autor, scheinen sich in diesem Werk zu vermischen. Auch wenn er erklärt, nicht journalistisch gearbeitet zu haben, hat man beim Lesen oft das Gefühl, eine nüchterne Reportage in den Händen zu halten. Die Einschätzung des französischen Schriftstellers Frédéric Beigbeder, Guez hätte eine neue Romanform geschaffen, mutet befremdlich an. Da trifft es der Erklärungsversuch des Autors im Deutschlandfunk-Interview besser: „Es ist eine literary non-fiction – eine Erzählung oder ein Dokumentarroman oder etwas dazwischen.“
Um die Lebensgeschichte des „Todesengels von Auschwitz“ ranken sich viele Legenden. Das Verdienst des Romans ist es, die Lücken zu schließen, die trotz Mengeles Tagebüchern und zahlreicher Literatur über seine Person in den Berichten bestehen geblieben sind. Wer allerdings eine fesselnde Fluchtgeschichte erwartet, wird enttäuscht werden.
MAUER MIT BLUMEN BEMALT
Die Idee, ausgewählte Gedichte des Chilenen Enrique Winter aus drei verschiedenen Bänden ins Deutsche zu übersetzen und in einem Band zu veröffentlichen, kam den Übersetzer*innen Léonce W. Lupette, Sarah Otter und Johanna Schwering nach Winters eindrucksvoller Performance beim Poesiefestival Latinale 2012 in Berlin. Die Übersetzung ist nun nach jahrelangem Arbeitsprozess erschienen und der Koproduktion entsprechend so vielstimmig wie der Text selbst.
Die thematische Bandbreite erschwert es, dem Band in wenigen Worten gerecht zu werden. Die Reise, die Landschaft, die Tiere, Mauern, Faschos im Alltag, Tränengas: Lateinamerika. Die Vielseitigkeit der Themen lässt sich vielleicht durch drei Begriffe auf den Punkt bringen, die über all diesen Schlagwörtern schweben: Zerrissenheit, Vergänglichkeit und Abwesenheit. „Die Beständigkeit ist zerbrechlich“ und alle menschlichen Bindungen sind vergänglich, das ist Winters Appell.
Enrique Winter, geboren 1982 in Santiago de Chile, ist in Valparaíso aufgewachsen und war unter anderem als Verleger und Anwalt tätig. Sein Werk umfasst mehr als 100 Publikationen in sechs Sprachen, darunter Gedichte, Übersetzungen, Videos und ein Roman. So unmittelbar eindrucksvoll Winters Performances sind, die Lektüre seiner Gedichte erfordert etwas Geduld, da sie sich zum Großteil nicht gleich erschließen, sondern über subtile Andeutungen funktionieren. Die Sprache ist teils geradezu hermetisch und lebt von Metaphern und Gedankenfetzen, die Interpretationsspielraum lassen. Die plastischen Bildformationen sind jedoch trotz aller Offenheit immer gewaltig und scheinen auf etwas Großes hinzuweisen, wenn auch oft nicht klar wird, auf was genau. Und genau das ist Winters große Stärke.
Seine Texte hinterlassen von Beginn an ein diffuses Gefühl: Das Bild des ewig am Strick pendelnden und dennoch vergessenen Großvaters eröffnet den Band. Leben und Lesen ist hier ein Balanceakt, der zwischen gegensätzlichen Polen pendelt.
Viele der Texte nehmen uns mit auf eine Busreise durch Lateinamerika und seine Geschichte. Mauern werden zwar umfahren, sind aber immer präsent. Die Gefahr, dem reinen Tourismus zu erliegen, lauert überall. „Ja, es ist ein Unheil, wie Besuch durchs Leben zu gehen“, heißt es.
Andere Gedichte sind größtenteils im Chile nach der Militärdiktatur situiert und erzählen Anekdoten aus dem Leben der Arbeiter*innen. Winter kommentiert auf subtile Art die sozialen Konstellationen, lässt die Verschwundenen der Diktatur aufleben, ohne diese jemals wirklich zu benennen. Alles ist von einer dichter Bildsprache durchzogen. Einige der Gedichte beziehen sich aufeinander, so ist beispielsweise Der Himmel ist kleiner als die Wolkenkratzer aus Versen anderer Gedichte Winters zusammengesetzt. Neu angeordnet und miteinander vermischt entstehen völlig neue Bilder. Die Vielseitigkeit der Themen wird von der Vielstimmigkeit der Figuren begleitet. Unterschiedliche Personen kommentieren die Ausführungen des Lyrischen Ichs, unter anderem die von Miguel, der sagt: „Ich war alles, nichts lohnt sich“. Auch formal ist Winters Lyrik experimentierfreudig, einige Gedichte erinnern an Kurzgeschichten, in anderen sind textuelle Lücken im Text auch inhaltliche, die die Leser*innen selbst ausfüllen müssen. An die Notwendigkeit, diese Leerstellen im Text und im Leben mit Leben zu füllen, erinnert uns Enrique Winter immer wieder.
VERERBTE GEWALT
Was wäre passiert, hätten die Entführungen, die Massaker, der Krieg nicht stattgefunden? Was, wenn dieser Mord nicht geschehen wäre, der Mord an dem linken Präsidentschaftskandidaten Jorge Eliécer Gaitán?
Der Tag seiner Ermordung, der 9. April 1945, „ist ein schwarzes Loch in der kolumbianischen Geschichte“. El Bogotázo, der darauf folgende Aufstand in der Hauptstadt, kostete mindestens 3.000 Menschen das Leben und stürzte das Land ins Chaos. Zehn Jahre lang kämpften Konservative und Liberale in einem offenen Bürgerkrieg um die Macht. Der Mord an Gaitán war der Auslöser einer „kollektive(n) Neurose“, schreibt Vásquez. Es war das Wiederaufflammen des bis heute andauernden Krieges zwischen progressivem und reaktionärem Denken in Kolumbien.
Juan Gabriel Vásquez geht in Die Gestalt der Ruinen nicht der Frage nach, wie das Land ausgesehen hätte, wäre Gaitán nicht ermordet worden. Der Schriftsteller fantasiert nicht über Utopien, sondern beschäftigt sich mit den dadurch zum Leben erweckten Verschwörungstheorien. Hat der 27-jährige Mörder, Juan Roa Sierra, an jenem Mittag allein gehandelt? Was sagen die Bilder, Erinnerungen und sogar Überreste Gaitáns über dessen Tod und den vieler anderer Politiker aus?
„Das Buch ist ein Exorzismus“, sagt der Autor im Interview mit der kolumbianischen Zeitung El País. In dem 520-seitigen Roman erhalten die Leser*innen Einblicke in das Leben von Vásquez, der mit 45 Jahren bereits als einer der wichtigsten lateinamerikanischen Schriftsteller der Gegenwart gilt. Sein Buch ist eine persönliche Auseinandersetzung mit der Gewalt der 1980er Jahre, als der Drogenkrieg das Land mit aller Wucht traf: „Wir alle erlebten, wie unsere Häuser abbrannten, wir alle waren in diesen Bürgerkrieg verwickelt, der natürlich kein Bürgerkrieg war, sondern ein Massaker, feige, unbarmherzig, tückisch, an verletzlichen und zudem unschuldigen Menschen.“ Der Roman ist gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit der nicht erlebten, sondern erzählten Gewalt, mit den Lebensgeschichten der Großeltern während des Bürgerkrieges nach dem Mord an Gaitán – Geschichten, die über die Zeit zu Legenden in jeder kolumbianischen Familie wurden.
Vásquez erzählt, wie er auf einer Party des Arztes Francisco Benavides die Bekanntschaft von Carlos Carballo machte. Carballo ist ein Verschwörungstheoretiker, der von der Geschichte um und von Gaitáns Ermordung besessen ist. Die Beziehung zwischen dem Schriftsteller Vásquez, dem Arzt Benavides und dem Verschwörungstheoretiker Carballos wird zum roten Faden im komplexen Geflecht von realen und fiktiven Detektivgeschichten.
Die Gestalt der Ruinen, drei Jahre nach dem Erscheinen nun auf Deutsch übersetzt, ist meisterlich geschrieben. Mit journalistischem Stil nimmt Vásquez mal die Perspektive des Schriftstellers, mal die des Historikers, des Kriminologen oder die seiner Zeug*innen ein. Im stetigen Wechsel der Erzählperspektiven führt der Autor die Leser*innen im zweiten Teil des Romans zurück in die Vergangenheit, an einen Tag im Jahr 1914, als Rafael Uribe Uribe, General und Politiker der Liberalen Partei, getötet wurde – ein weiterer angekündigter Tod in der kolumbianische Politik mit viel verschwörungstheoretischem Potenzial.
„In dem Roman habe ich versucht, mich mit einer meiner Sorgen auseinanderzusetzen, nämlich der, dass wir Kolumbianer die Verbrechen vererben, die Gewalt in unserem Leben”, sagte Vásquez weiter im Interview mit El País. Sein Vorhaben gelingt ihm: Der erzählte Weg dorthin macht den Roman höchst aktuell und sehr lesenswert.
VERFRÜHTE MIDLIFE-CRISIS
Sie waren zu viert: Aurora, Emiliano, Antero und Andrei „Duke“ Dukelsky. Ein Quartett, das um die Jahrtausendwende das digitale Fanzine Orangotango publizierte, Wegbereiter des Internets, Millennials, bevor man von Millennials sprach. Jung, wild, populär, belesen und provokativ erleben sie die intensivste Zeit ihres Lebens gemeinsam in Porto Alegre. Doch was bleibt, wenn junge Wilde älter werden? Aurora hat trotz ihres Erfolgs als Bloggerin den Journalismus geschmissen und schlägt sich als Doktorandin mit bahnbrechenden Forschungen zu Zuckerrohr und misogynen Professoren herum. Andrei veröffentlichte drei Romane und wird „eines der vielversprechensten Talente der zeitgenössischen brasilianischen Literatur“; gleichzeitig begeht er „digitalen Selbstmord“, indem er alle seine Internet-Accounts löscht. Antero berät die ganz großen Firmen zu Kommunikations-Strategien, hat Geld, Frau, Kind und eine Reihe Online-Affären. Emiliano, sieben Jahre älter als die anderen, wird mäßig erfolgreicher freier Journalist und Autor, der offen schwul lebt.
Viel miteinander zu tun haben sie, 15 Jahre nach der Zeit mit Orangotango, nicht mehr. Dann stirbt Andrei völlig überraschend, erschossen bei einem Raubüberfall auf seiner Joggingrunde. Anlass für Aurora, Antero und Emiliano den Freund zu beerdigen, auf Spurensuche in die Vergangenheit zu gehen und die Frage zu beantworten, wer der immer rätselhafte „Duke“ eigentlich war.
Der Autor Daniel Galera – auch er ist 1979 geboren, lebt in Porto Alegre und gilt als großes Talent der zeitgenössischen brasilianischen Literatur – wählt die eher konventionelle Ausgangssituation eines plötzlichen Todesfalles, um viele kleine und einige größere Geschichten aus den „Nullerjahren“ zu erzählen, immer wieder durchbrochen von Ausflügen in das heutige Brasilien: die Streiks der Busunternehmen, die großen Proteste von 2013, die immer weiter zunehmende Gewalt auf den Straßen. Er bleibt dabei ganz in seinem Universum der brasilianischen Mittelklasse, ihren Aufstiegsnöten und Abstiegsängsten. Das große Thema des Romans So enden wir (im Original „Zwanzig nach zwölf“), atmosphärisch und sprachlich überall angedeutet, ist aber eine irgendwie drohende Apokalypse: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendwas bessern wird. Jeder weiß doch, was falsch läuft und was man besser machen könnte, aber was gemacht werden könnte, wird nicht gemacht, und deswegen kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es gemacht werden könnte. Ich fürchte, ich gehöre allmählich zu den Leuten, die an das Ende der Welt glauben. Dabei fand ich das immer so lächerlich“, sagt Aurora, als sie zu dritt nach der Beerdigung in „ihrer alten“ Bar sitzen.
Aurora als Biologin übernimmt den Part der Mahnerin in der Wüste, zieht auch die radikalsten Konsequenzen aus ihrer Kritik. Doch mit dem Fortgang der Handlung wächst das deutliche Gefühl, dass es den dreien nicht wirklich um eine drohende ökologische Katastrophe oder fehlende gesellschaftliche Veränderung geht, sondern sie ganz einfach von „Lebensüberdruss“ geplagt werden. 15 Jahre nach den intensiven, wilden Zeiten ist ihr Leben schal geworden. Am Ende folgt Aurora einem Fabelwesen in den Wald und Emiliano macht eine gänzlich neue sexuelle Erfahrung: „Es war ein neues, unerschlossenes Terrain, etwas, das ich noch nicht kannte und das mich mit einer Energie erfüllte, die ich mir für später aufbewahren würde. Für einen Moment in der Zukunft, der alles sein konnte, nur nicht langweilig. Solange diese Art von Energie existierte, dachte ich, bevor ich einschlief, solange ein paar von uns sie noch in sich spürten, auch wenn wir sie gerade nicht nutzten, würde unsere Welt weiterbestehen.“ Liest man den Roman als aktuelles Psychogramm der aufgeklärten brasilianischen Mittelklasse, dann ist an Verbesserungen wirklich nicht zu denken.
BEGEHREN NACH CORTÁZARS ART
„‚Sie sind wie die Katzen… wie zankende Katzen.‘ Carlos María dachte an das fürchterliche Geschrei nachts auf den Dächern. Aber er wusste auch, dass Katzen sich unter dem Vollmond nicht zanken.“ Was machen wohl Katzen nachts unter dem Vollmond? Und was ist das für eine Beziehung zwischen Marta und Carlos María, den Katzen in dieser Geschichte? Das fragen sich nicht nur die beiden selbst, sondern auch die Leser*innen. Als Cousin und Cousine wachsen Carlos María und Marta in der Familie Hilaire in Buenos Aires auf. Sie spielen zusammen, sie ziehen sich gegenseitig auf, sie mögen sich, sie hassen sich. So wie das Geschwister eben tun. Doch mit der Zeit verwandelt sich ihr Verhältnis in etwas Anderes. Für die Leser*innen ist die sexuelle Spannung spürbar, für die Hauptpersonen sind die Gefühle des*r jeweiligen Anderen ungewiss. Dann findet Carlos María einen Brief, der alles zu ändern scheint. Und als er seine Eltern damit konfrontiert, stiften sie noch mehr Chaos.
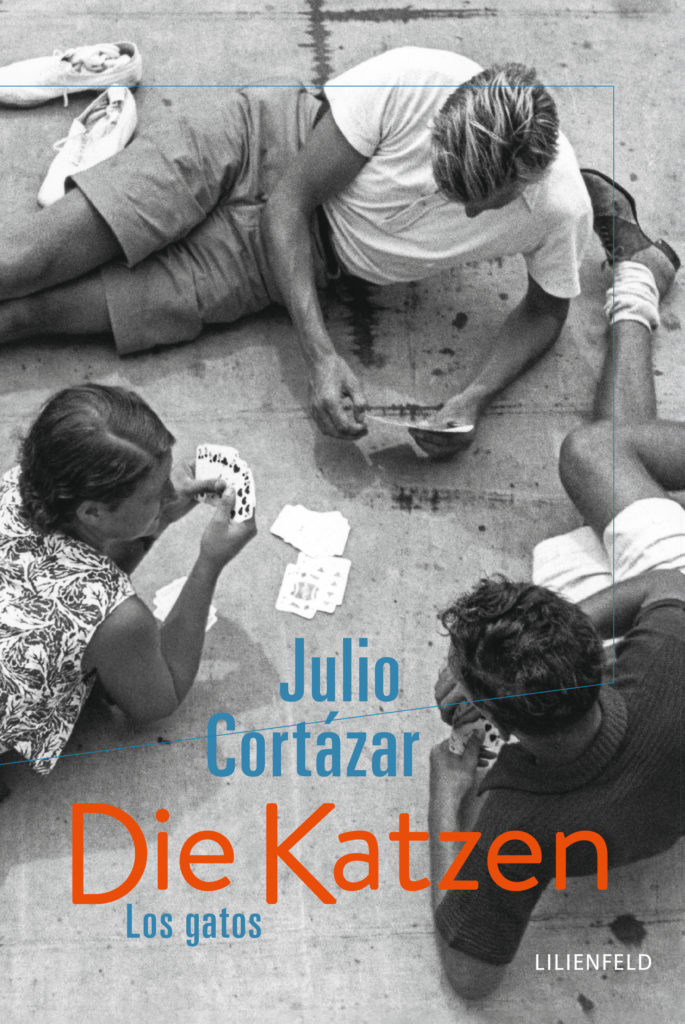
In Die Katzen behandelt Cortázar die Themen des Erwachsenwerdens und des verbotenen Begehrens. Auf fesselnde Weise schildert er die Zerrissenheit zweier junger Menschen zwischen ihren Gefühlen und den Tabus ihrer Umgebung. Deutlich ist auch der Konflikt mit den Eltern, die mit ihrer Geheimnistuerei das Leben der beiden ruinieren.
Form und Stil des Werks erinnern an andere Erzählungen Cortázars wie El Perseguidor (Der Verfolger) und die übrigen in dem Band Las armas secretas (Die geheimen Waffen). Man findet seine lakonischen und ironischen Kommentare wieder, das Ende ist offen. Nach typischer Art des Autors sollen die Leser*innen viele Leerstellen füllen. Was eine mehrfache Lektüre erlaubt, die jedes Mal anders ist.
Die Katzen ist die bisher einzige auf Deutsch erschienene Erzählung unter den 2009 in Cortázars Nachlass überraschend aufgefundenen papeles inesperados. Die Übersetzung ist innerhalb eines Mentoringprojekts der Kunststiftung NRW entstanden, die die Zusammenarbeit einer herangehenden Übersetzerin mit einem erfahreneren Kollegen erlaubt hat. Die Ausgabe ist zweisprachig, man kann den Text also wunderbar im Original genießen und auf die Übersetzung zurückgreifen, wenn verzwickte argentinische Wörter auftauchen. In der Theorie. In der Praxis empfinden das wohl die meisten Menschen mit nicht allzu perfekten Spanischkenntnissen schon nach kurzer Zeit als nervig und lesen einfach auf Deutsch weiter, weil der Text sie in seinen Bann zieht.
Überhaupt endet die Lektüre viel zu schnell, und es bleibt ein kurioses Gefühl der Nostalgie zurück, ein Bedauern, sich dafür nicht mehr Zeit genommen zu haben. Genau dann bietet es sich an, nochmal zurückzublättern und sich auch die Originalversion vorzunehmen.
GEFANGEN IM SCHLEIER AUS BLUT
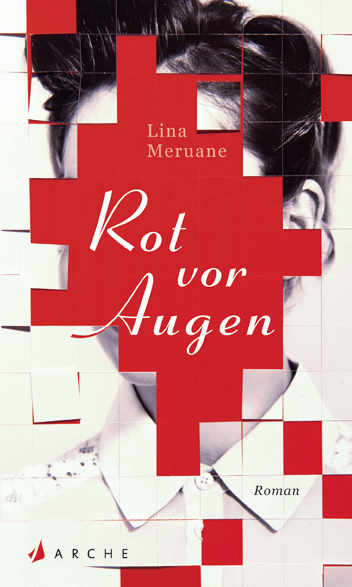
Das Motiv der Blindheit spielt schon seit der Antike eine bedeutende Rolle in Kunst und Literatur. Homer war angeblich blind. Bei Max Frisch, Ingeborg Bachmann, Peter Handke und vielen anderen deutschen Nachkriegsautor*innen spielen blinde Figuren wichtige Rollen. Jorge Luis Borges malte nach seiner Erblindung gar ein Selbstportrait. In vielen Büchern sind Blinde geradezu mythologische Figuren, die ein Hauch von Weisheit, Heldenhaftigkeit und überirdischer Kraft umweht. Lina Meruane, geboren 1970 in Santiago de Chile, zerschmettert diesen Mythos mit derselben Kraft und Geschwindigkeit, mit der das Blut in die Augen der Protagonistin ihres Romans Rot vor Augen schießt.
Meruane, die momentan im Rahmen des Künstlerprogramms des DAAD in Berlin lebt, ist für die spanische Originalversion, Sangre en el ojo, bereits 2011 mit dem Anna-Seghers-Preis ausgezeich-net worden. Es ist ihr erster Roman, der nun ins Deutsche übersetzt wurde.
Eines Abends, inmitten einer Par-ty in New York, geschieht es: Die Protagonistin Lina, die genauso heißt wie ihre Autorin – nur einer von vielen autobiographischen Zügen des Romans –, erblindet. Ihr Augenarzt, ein grummeliger, älterer Herr namens Lekz, hatte sie aufgrund ihrer Diabetes schon lange davor gewarnt. Linas Verhalten nach ihrer Erblindung ist alles andere als heldenhaft. Mit medizinischer Präzision beschreibt Meruane die Besuche bei Lekz, die plötzliche Tollpatschigkeit Linas, die Verletzungen, die sie sich in der eigenen Wohnung zuzieht, weil sie sich nicht mehr zurechtfinden kann. Ihre Blindheit hat nichts Metaphorisches, wie wir es aus anderen Büchern vielleicht gewöhnt sind. Sie ist geradezu unheimlich real.
Ihrem Partner Ignacio begegnet sie bisweilen mit Boshaftigkeit, fordert ihn ständig heraus und ist vor allen Dingen besitzergreifend. „Ignacio, flüsterte ich und blies dir ins Gesicht, wiederholte deinen Namen dann lauter und drückte deinen Arm. Aber du hast nicht geantwortet, dein Wille war betäubt, du warst wie ein Toter, aber ein Toter, der ganz und gar mir gehörte.” Lina ist in ihrer Verzweiflung unberechenbar, doch sie ist auch liebevoll und verletzlich. Sie, eine Schriftstellerin, kann nun weder schreiben noch lesen, und damit kann und will sie nicht zurechtkommen. Sie ist bereit alles zu tun, um ihr Augenlicht zurück zu erlangen und erwartet, dass die Leute um sie herum, allen voran Ignacio, ebenso alles dafür tun.
Die kurzen Kapitel prasseln mit spitzer und vernichtender Sprache auf uns ein und rechnen knallhart mit einer Gesellschaft ab, in der versucht wird, Krankheit zur Privatsache zu machen. Manchmal ironisch und manchmal bitterernst konfrontiert uns Rot vor Augen mit einer Sackgasse, in der kein Raum für Neuverhandlungen der Identität geschaffen werden kann, obwohl der Versuch, genau dies zu tun für Lina die einzige Chance ist zu überleben. Sprache und Gefühle der Protagonistin sind in Meruanes Prosa eins. Ist Lina unbeholfen, ist es auch ihre Sprache, ist sie berechnend und kalt, treffen uns ihre Worte messerscharf. Nicht zuletzt deswegen ist Meruanes Stil unverkennbar und einzigartig, und das Leseerlebnis, insbesondere das fulminante Ende, eine schonungslose Konfrontation mit den dunkelsten Tiefen des menschlichen Körpers und seiner Psyche.
SIEBEN LEERE SEELEN
Nichts ist sicher, nicht die Vergangenheit oder die Erinnerung, nicht die Gegenwart, erst recht nicht die Zukunft. Und schon gar nicht das eigene Zuhause. Sieben leere Häuser heißt Samanta Schweblins Band mit sieben Erzählungen, doch es geht auf den ersten Blick gar nicht so sehr um die Häuser selber, sondern darum, wie ihre Protagonist*innen die Häuser verlassen, einem unerklärlichen Drang folgend, dem sie sich nicht widersetzen können.
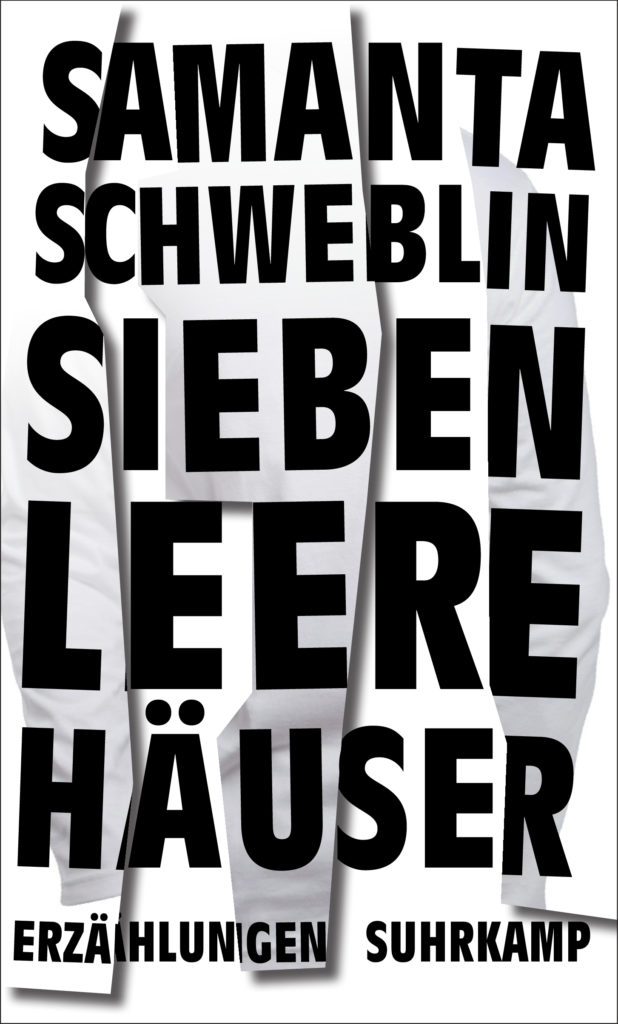
Schweblin, 1978 in Buenos Aires geboren, lebt zurzeit in Berlin. Nach dem Erzählband Die Wahrheit über die Zukunft (2010) und dem Roman Das Gift (2016; s. LN 503) ist Sieben leere Häuser nun ihr drittes Buch in deutscher Übersetzung. Die Erzählstimmen sind die von sechs Frauen unterschiedlichen Alters und eines Mannes. Da ist zum Beispiel die offenbar demente Lola, die auf der Suche nach dem Tod ist und ihn nicht finden kann, weil sie glaubt, von dem Nachbarsjungen terrorisiert zu werden. Da ist der Mann, der sich vor seiner Ex-Frau für seine nackt durch den Garten tanzenden Eltern rechtfertigen muss, und die Frau, die nur mit einem Bademantel bekleidet ihre Wohnung verlässt, um einem Gespräch mit ihrem Partner aus dem Weg zu gehen und schließlich im Wagen des Hausmeisters eine Spazierfahrt durch Buenos Aires beginnt. Und da ist ein achtjähriges Mädchen, das sich an seinem Geburtstag die Aufmerksamkeit der mit dem Notfall der kleinen Schwester beschäftigten Eltern zurückerkämpft, indem es mit einem fremden Mann ausbüxt, um eine Unterhose zu kaufen.
Einige Figuren suchen die Grenzüberschreitung, um sich lebendig fühlen zu können. Andere wiederum klammern sich auf der Suche nach dem Sinn ihres Daseins an irgendeine Art von Ordnung – wie die der Lebensmittel im Kühlschrank oder des perfekten Zuschnitts der Pinien im Garten – oder legen repetitive Verhaltensmuster an den Tag, werfen zum Beispiel regelmäßig die Klamotten des verstorbenen Sohnes in den Nachbargarten oder fahren in reichen Vierteln herum, um sich dort die Häuser anzusehen und wertvolle persönliche Dinge zu stehlen, nur um diese dann im eigenen bescheidenen Garten vergraben zu können.
Manche der Erzählungen eskalieren am Ende, andere lassen uns im Ungewissen. Die Sprache, im Einklang mit der unterschwelligen Spannung, ist auch in der Übersetzung lakonisch, schlicht und geradlinig. Die Gefahr lauert in allen Ecken, doch wir wissen meistens gar nicht, worin sie besteht oder warum sie überhaupt gefährlich ist. Wir wissen nur, dass alle Figuren etwas verloren haben oder etwas zu verlieren glauben, dass sie trotz der Gesellschaft der Familie oder der Partnerschaft, in der sie sich allesamt befinden, schonungsloser Einsamkeit ausgesetzt sind und dieser zu entkommen versuchen, indem sie durch die Straßen ziehen und sich Fremden anvertrauen, ohne jedoch je wirklich etwas preiszugeben. Namenlos die meisten Erzählstimmen, namenlos die Fremden. Er, sie, die Frau, mein Mann, meine Mutter. Schweblin führt uns rücksichtslos in die Hölle der zwischenmenschlichen Beziehungen des 21. Jahrhunderts und lässt nichts als leere Häuser und leere Seelen zurück. Und das auf äußerst virtuose Art und Weise.
HOFFNUNG IN EINER HOFFNUNGSLOSEN WELT
 Contreras Castro nimmt uns mit in eine Geschichte, in welcher sich die Grenzen zwischen der harschen sozialen Realität eines Bordells und dem scheinbar Unvorstellbaren ständig verschieben und sogar ganz zu verschwinden scheinen. In bildreicher Sprache hat Contreras eine Erzählung geschaffen, in der die Figuren des Romans versuchen, sich der Gewalt, der Ohnmacht und schlussendlich auch der Absurdität des Alltags mit bedingungsloser Liebe, mit Zusammenhalt und Akzeptanz entgegenzustellen.
Contreras Castro nimmt uns mit in eine Geschichte, in welcher sich die Grenzen zwischen der harschen sozialen Realität eines Bordells und dem scheinbar Unvorstellbaren ständig verschieben und sogar ganz zu verschwinden scheinen. In bildreicher Sprache hat Contreras eine Erzählung geschaffen, in der die Figuren des Romans versuchen, sich der Gewalt, der Ohnmacht und schlussendlich auch der Absurdität des Alltags mit bedingungsloser Liebe, mit Zusammenhalt und Akzeptanz entgegenzustellen.
Wir lernen Consuelo kennen, die seit dem Arbeitsunfalls ihres Mannes als Köchin in dem Bordell lebt und arbeitet und als gute Seele das Haus zusammenhält.
Ihr Bruder Jerónimo, ein wohl verrückter Ex-Mönch, befindet sich auf ständigen ziellosen Streifzügen durch die Stadt und nimmt die Welt auf seine ganz eigene Weise war. Er erklärt sich die Welt anhand eines Wissens, welches aus Büchern des 16. Jahrhunderts stammt, was ihn jedoch nicht davon abhält seine bisweilen kruden Anschauungen in der Realität bestätigt zu finden.
Im Mittelpunkt des Buches steht aber das Leben des kleinen Polyphem. Als Sohn eines von zu Hause verstoßenen Mädchens wird er in dem Bordell in San José geboren. Er wäre wohl ein ganz normales Kind, – wäre da nicht das große, tiefschwarze und leuchtende Auge auf seiner Stirn.
Während sich alle vor dem kleinen Monster fürchten, nimmt sich Jerónimo ihm liebevoll an, um ihm später all das, sprichwörtlich Ungeheuerliche, beizubringen, was er über das Leben weiß.
Behütet und vor den Augen Fremder versteckt, wächst der kleine Polyphem im Hof des alten Hauses auf – bis ihn eines Tages die Neugierde packt. Das Auge unter einer großen Mütze versteckt, begleitet er Jerónimo auf einen seiner Streifzügen durch die Stadt, um die Welt mit seinem eigenen Auge zu sehen. Schnell schließen die beiden Freundschaften und so nehmen uns der Mönch und das Kind, in den vielen darauf folgenden Anekdoten mit – in ihre Stadt.
Contreras überzeugt durch großes Wissen, eine noch größere Phantasie und erzählerisches Talent.
Besonders in den genialen, wie naiven, aber immer bizarren und skurrilen Anschauungen Jerónimos, spielt Contreras geschickt mit dem Spannungsverhältnis von Glauben und Wissen, welches unsere Perspektiven und somit unsere Wahrnehmung der Welt mitbestimmt. Jerónimos Zugang zur Welt erweitert die harsche Realität des Alltags um magische Elemente– und lässt die Lesenden nicht selten schmunzelnd, lachend, andere Male ungläubig und traurig zurück.
Mit einem kritischen Blick stellt Contreras in diesem teils komödienhaften, teils bedrückenden Buch Fragen von großer gesellschaftlicher Relevanz und schafft eine Geschichte der Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Auf Deutsch zuerst erschienen 2002 im Maro Verlag. Seit 2011 erscheint es im Unionsverlag.







