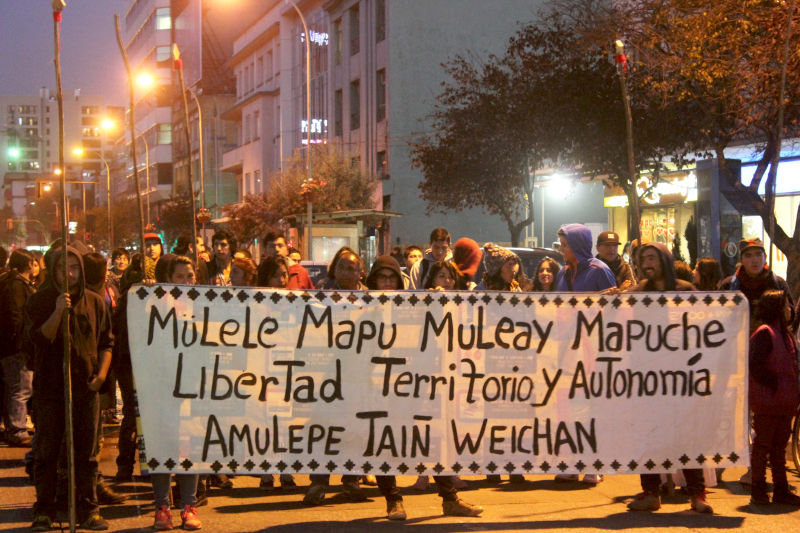Ende Mai gab es reges Medieninteresse für eine kleine Insel in Panama. In vielen Ländern erschienen Artikel und Fernsehberichte zur Umsiedlung des Dorfes Gardi Sugdub („Krabbeninsel“), die von den indigenen Guna bewohnt wird und zuletzt auf einer Größe von fünf Fußballplätzen etwa 1.500 Einwohner*innen hatte. Sie liegt einen guten Kilometer vor der karibischen Küste im Norden des Landes, zwischen dem Panamakanal und Kolumbien. Weitere über 30.000 Guna leben dort, auf einer Länge von 200 km verstreut, auf Dutzenden solcher Inseln.
Das große Interesse rührte auch daher, dass zum ersten Mal auf dem amerikanischen Kontinent Menschen eine Insel unter anderem aufgrund des Klimawandels verlassen haben. Seit Jahren beobachten die Bewohner*innen eine Zunahme extremer Wetterereignisse. Meterhohe Wellen verursachen besonders zwischen November und Februar Zerstörung und führen zu Überschwemmungen. Die Insel Gardi Sugdub erhebt sich nur einen halben Meter über den Meeresspiegel, und laut der Weltorganisation für Meteorologie steigt der Meeresspiegel in Lateinamerika und der Karibik schneller als im weltweiten Durchschnitt.
Am 29. Mai weihte der damalige Präsident Laurentino „Nito“ Cortizo die neue, nahe gelegene Siedlung Isber Yala auf dem Festland mit dreihundert Häusern ein, die jeweils einer Familie 41 Quadratmeter Wohnfläche mit Wasser- und Stromanschluss bieten. Auf der Plattform X schrieb er:„Angesichts des Risikos für die Bewohner hat unsere Regierung vereinbart, eine neue Siedlung zu gründen, um ihre Zukunft zu sichern.“ Zugleich eröffnete er die sanierte Straße zum Dorf und eine Schule.

Die Umsiedlung der Bewohner*innen von der Insel in ihre neuen Häuser auf dem Festland fand schließlich zwischen dem 3. und dem 8. Juni statt. Dreihundert Familien mit insgesamt etwa 500 Kindern machten vom Angebot der Regierung Gebrauch und erhielten kostenlos ein Haus in der neuen Siedlung. Viele sind mit ihrer neuen Lebensumgebung zufrieden, darunter Dialicia Mendoza, die mit ihrer Schwester nun eines der neuen Häuser bewohnt. Gegenüber Eco News sagte sie nach dem Umzug, sie sei von dem neuen Haus begeistert und sehr stolz darauf.
Es gibt jedoch auch Bewohner*innen, die nicht umgesiedelt wurden, offiziell 32 Familien. Einerseits, weil es nicht genug Häuser für alle gab, aber auch, weil einige es vorzogen, auf der Insel zu bleiben – trotz der Risiken des steigenden Meeresspiegels und obwohl es auf der Insel kein Trinkwasser gibt. Das muss per Boot mit Kanistern aus dem Fluss vom Festland geholt werden. Zu ihnen gehört Ana Herrera (Name von der Red. geändert), die im Gespräch mit LN erzählt: „Mir persönlich gefällt nicht, wie die neue Siedlung errichtet wurde. Wenn ich auf dem Festland leben möchte, würde ich mein Haus gern selbst gestalten.“ Ana spielt darauf an, dass die neuen Häuser auf dem Festland keine traditionellen Hütten sind, sondern Fertigbauhäuser aus Zement, wie man sie auch in den barriadas der Hauptstadt findet. Zudem sind 41 Quadratmeter Wohnfläche für die oft großen Familien der Guna zu klein.
Der moderne Charakter der Häuser war ursprünglich nicht so geplant und ergab sich während eines längeren Prozesses, der bereits im Jahr 2010 begann. Damals beschloss das Dorf, auf das Festland umzuziehen – noch nicht wegen des Klimawandels, sondern aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte auf der kleinen Insel. Die Dorfgemeinschaft gründete eine Kommission für die Umsetzung der Umsiedlung, suchte sich ein geeignetes Grundstück auf dem Festland und rodete den dort befindlichen Wald. Um für alle Dorfmitglieder auf einmal neue Häuser zu bauen, gab es vor Ort jedoch nicht genug traditionelles Baumaterial, wie etwa die Blätter der Weruk-Palme, die die Guna für ihre Dächer verwenden. Die Kommission bat daher die damalige Regierung von Ricardo Martinelli um Hilfe, die auch Unterstützung zusagte – sie sollte allerdings im Rahmen eines bestehenden Häuserbauprogramms erfolgen, anstatt an die Bedürfnisse der indigenen Gemeinschaft angepasst zu sein. Und auch diese Unterstützung erfolgte offenbar nur halbherzig: Die Regierung begann zunächst, eine Krankenstation und eine Schule zu errichten, doch bevor es zum Bau der Wohnhäuser kam, wurden die Mittel plötzlich dringender in anderen Provinzen benötigt. Dann passierte jahrelang nichts, die Ruine der unfertigen Krankenstation steht bis heute nahe der neuen Siedlung. Die Mitglieder der Kommission und die anderen Leute im Dorf diskutierten in dieser Zeit darüber, ob es besser wäre, weiter nach einer zuverlässigeren Finanzierung zu suchen, um die neuen Häuser gemäß ihrer Tradition mit Naturmaterialien bauen zu können. Viele verloren mit der Zeit jedoch die Geduld, und als im Jahr 2019 Nito Cortizo an die Macht kam und die brachliegenden Arbeiten mit Fördermitteln der Weltbank fortsetzen wollte, begrüßten dies viele Bewohner*innen.

Immerhin: Die beiden großen, traditionellen Gemeinschaftshäuser als Orte, in denen sich das politische und zeremonielle Dorfleben bei den Guna abspielt, haben die Bewohner*innen auch in der neuen Siedlung errichtet. Sagla José Davies, der Dorfvorsteher, meinte in den Tagen des Umzugs gegenüber Voz de América: „Wir bewahren unsere Gebräuche und Traditionen und haben die Dinge, die dafür wichtig sind, von der Insel hierher mitgebracht, wie das Versammlungshaus mit seinen Hängematten.“ Trotz dieser Versicherung bekommen die Bewohner*innen von Isber Yala dieser Tage auch kritische Kommentare von Guna aus anderen Dörfern, die weiterhin in Hütten leben. Diese befürchten, dass der Umzug in eine Siedlung mit gewöhnlichen Zementhäusern die Kultur und Lebensweise letztlich verändern wird. Evelio López, der aus Gardi Sugdub stammt und auf der Nachbarinsel Miria Ubigandub als Lehrer arbeitet, sieht es dagegen eher wie der Sagla. Für ihn spielt bei solchen Kommentaren auch Neid auf die moderneren Häuser eine Rolle. Er schrieb dazu Ende Juni auf Facebook: „Wenn die Menschen von Gardi Sugdub heute in moderneren Häusern mit westlichem Lebensstil besser eingerichtet sind, bedeutet das nicht, dass sie deswegen ihre Gebräuche oder Kultur ändern“. Und was bedeutet der Umzug für das Leben derjenigen, die auf der Insel Gardi Sugdub geblieben sind, wo nun viel weniger Menschen leben sollten? Für Ana Herrera ist diese Frage im Gespräch mit LN nicht so leicht zu beantworten. Der Grund überrascht, da er in dem breiten Medienecho etwas unterging: „Es ist zu früh, um das zu beurteilen, da die Umgesiedelten noch nicht vollständig umgezogen sind. Im Moment der Umsiedlung gab es in der neuen Siedlung nämlich noch keinen Strom und daher auch noch kein fließendes Wasser. Ich denke, viele werden wohl auf der Insel bleiben, bis alles fertig installiert ist, immerhin wird daran gearbeitet. Innerhalb eines Jahres werden wir sehen, wer dann wirklich umgezogen sein wird. Es sind vor allem junge Paare und Familien, die sich für die Umsiedlung entschieden haben.“
Warum hat die Regierung mit der Umsiedlung nicht gewartet, bis die Bauarbeiten abgeschlossen waren? Blas López*, Soziologe und ehemaliges Mitglied der Umsiedlungskommission, hat es kurz vor dem Umzug für LN so eingeordnet: „Die Regierung ist am Ende ihrer Amtszeit, sie möchte demonstrieren, dass sie die Arbeiten abgeschlossen hat, wie das eben so ist mit Regierungen. Im Grunde wird die Umsiedlung jetzt nur simuliert, tatsächlich wird das ein längerer Prozess sein. Die Gemeinschaft der Guna hat ihre eigene kulturelle Dynamik.“
So könnte das Projekt der Umsiedlung von Gardi Sugdub ingesamt bis zu 15 Jahre in Anspruch nehmen. Diese Erfahrungen sind auch für die Guna der anderen Inseln relevant, die sich angesichts des fortschreitenden Klimawandels in den nächsten Jahrzehnten ebenfalls mit einer möglichen Umsiedlung beschäftigen müssen. Das gleiche gilt für weitere vom Klimawandel bedrohte, vulnerable Gemeinschaften in Lateinamerika. In vielen Fällen werden sie wie die Guna aus Gardi Sugdub nach dem Anstoßen eines Umsiedlungsprozesses auf die Hilfe ihrer Regierungen oder internationaler Organisationen angewiesen sein, die wie die Regierung Panamas oft auch eigene Interessen verfolgen und nicht unbedingt die Bedürfnisse der Betroffenen in den Vordergrund stellen.
* Anmerkung der Redaktion: Blas López ist im Juni 2024 gestorben.