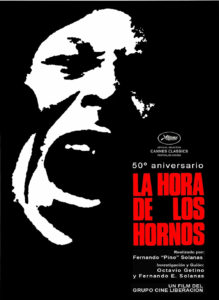Wo steht der Friedensprozess mit der Farc-Guerilla?
Das Abkommen mit der Farc ist nicht nur das Ende eines Krieges und die Abgabe von Waffen. Das Abkommen ist die Weichenstellung für einen sozialen Wandel in Kolumbien. Deswegen ist einerseits der fünfte Punkt, der die politische Partizipation regelt und über den aktuell sehr viel diskutiert wird, wichtig. Aber auch alle anderen Punkte sind entscheidend: Im gleichen Maße, wie etwa die Übergangsjustiz voranschreitet, muss auch die ländliche Entwicklung vorangetrieben werden – denn dort sind die meisten Opfer des Konfliktes. Die Kleinbauern müssen spüren, dass ihnen dieser Frieden etwas bringt. Die demobilisierten Rebellen müssen spüren, dass ihnen der Frieden etwas bringt. Gleichzeitig sehen wir jedoch in allen fünf Punkten des Abkommens wichtige Fortschritte. Der beste Beweis sind die vergangenen Präsidentschaftswahlen: Noch nie waren Wahlen in Kolumbien so friedlich, noch nie hatte ein linker Kandidat eine reale Chance. Bis dato beschäftigte uns bei Wahlen in erster Linie die öffentliche Sicherheit, und erst dann das Wahlergebnis. Sonst gab es rund um die Wahlen stets massive Drohungen, irgendwer hatte irgendwen entführt, irgendwelche illegalen Akteure hatten irgendein Wahllokal besetzt. Dass wir in Frieden wählen konnten und eine demokratische Wahl zwischen zwei entgegengesetzten Politikströmungen hatten, ist der beste Beweis dafür, dass der Friedensprozess voranschreitet.
Der frisch gewählte Präsident Iván Duque kritisiert vor allem die Übergangsjustiz (JEP), die eine weitgehende Amnestie im Austausch für die Aufklärung und Reparation begangener Taten garantieren soll, und die politische Beteiligung ehemaliger Farc-Kommandanten. Was halten Sie von der Kritik?
Es gibt eine Entscheidung des Verfassungsgerichtes, die regelt, wie die politische Beteiligung der ehemaligen Guerilleros aussehen soll. Die Möglichkeit, an der Politik mitzuwirken, ist der direkte Ausgleich dafür, dass die Personen ihre Waffen niederlegen und die Illegalität verlassen. Natürlich ist dieser Vorgang auch an bestimmte Bedingungen geknüpft, etwa die vollständige Aufklärung begangener Taten und die Reparation der Opfer. Die Debatte ist nicht unwichtig, weil die politische Beteiligung für die Anführer der Farc die Essenz des Friedensabkommens ist. Niemand legt seine Waffen nieder, wenn er dann ins Gefängnis kommt. Der Deal war: Die Farc hört auf zu versuchen, die Macht im Staat mit Waffen zu übernehmen, sondern begibt sich stattdessen auf das politische Schlachtfeld der Demokratie.
Was sind die bisherigen Erfolge des Friedensprozesses?
Der geplante Zeitrahmen für die Implementierung des Friedensprozesses beträgt 15 Jahre. Auch wenn wir uns wünschen würden, dass es schneller geht: Wenn wir das geplante Zeitfenster betrachten, kommen wir gut voran. In Punkto Erfolge: Es gibt einen realen Einfluss auf die Menschenrechte. In allen Menschenrechtsverletzungen, die in Kolumbien notorisch sind – Verschwindenlassen, Entführungen, Massaker, die Machtübernahme in Gemeinden – sind die Zahlen heute so niedrig wie noch nie. Es gibt Studien unabhängiger Organisationen die zeigen: Durch den Friedensprozess sind heute etwa 4.000 Menschen am Leben, die ohne den Prozess getötet worden wären. Und das wichtigste ist: Es gibt heute ein Kolumbien, das viel weniger Angst hat als vorher. Wir haben etwas naiv geglaubt, dass wir mit dem Friedensprozess sofort in einen Zustand der Harmonie übergehen würden. Dafür sind die Herausforderungen nach einem 53 Jahre währenden Binnenkonflikt zu groß. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg.
Was sind die Herausforderungen, vor denen der Friedensprozess aktuell steht?
Es gibt aktuell vor allem punktuelle Schwierigkeiten in einigen Regionen, insbesondere der Pazifikregion und im Catatumbo an der Grenze zu Venezuela. In diesen Gebieten kämpfen verschiedene bewaffnete Akteure um die Vormacht, parallel spielen der Drogenhandel und der illegale Bergbau eine Rolle. Das Ausmaß der Gewalt ist viel niedriger als früher, aber dennoch bedrohen diese Situationen den Friedensprozess. Andererseits: Wenn wir den Verlauf des Prozesses mit Vorgängen in anderen Ländern vergleichen, sind diese Probleme nicht ungewöhnlich. Gerade in einem Land wie Kolumbien, das sehr ungleich ist, wo extremer Reichtum und extreme Armut aufeinander treffen, ist es nicht überraschend, dass uns die Umsetzung des Friedensabkommens vor Herausforderungen dieser Art stellt.
Inwiefern beeinflusst die Wahl von Iván Duque, der als Kritiker des Abkommens bekannt ist und bereits „Korrekturen“ ankündigte, den Friedensprozess?
Unzählige Gesetze wurden bereits verabschiedet, sehr viele Programme laufen bereits – es wäre sehr schwierig, diese Prozesse umzukehren. Ein Regierungswechsel kann diese Dynamiken nicht aufhalten. Einerseits, weil das juristisch gar nicht möglich ist – aber auch, weil es eine sehr aktive Zivilgesellschaft gibt, die sich sehr engagiert für den Prozess einsetzt. Außerdem hat Kolumbien eine Reihe nationaler und internationaler Verpflichtungen zu erfüllen und steht einer internationalen Gemeinschaft gegenüber, die den Friedensprozess deutlich unterstützt. Was mich beruhigt, ist, dass etwa der Kongress, auch wenn eine … sagen wir eher konservative Partei [das Centro Democrático von Álvaro Uribe, Anm.d.Red.] die Mehrheit hat, seit den Wahlen im März einen deutlichen Einsatz für die Opfer des Konfliktes gezeigt hat. Und auch der neue Präsident hat bereits verkündet, sich für die Opfer und die Reintegration der ehemaligen Rebellen einsetzen zu wollen. Ich denke und hoffe, der Friedensprozess wird weitergehen – auch wenn die Prioritäten sich vielleicht verschieben.
Iván Duque hat auch verkündet, die Gespräche mit der ELN-Guerilla aufzukündigen, sofern diese nicht eine Reihe unrealistischer Bedingungen erfüllt…
Zwei Dinge finde ich besonders interessant: Einerseits die Nachricht des Farc-Vorsitzenden Timochenko an Duque, der deutlich erklärt hat, den Prozess mit der neuen Regierung fortsetzen zu wollen und die demokratische Wahl zu akzeptieren. Diese Nachricht hat eine symbolische, aber auch eine politische Macht und sagt deutlich: „Arbeiten wir zusammen!“
Andererseits hat auch die Führung der ELN deutlich gemacht, dass sie die Friedensgespräche fortsetzen wollen. Das ist eine gute Nachricht, denn sie hätten auch das Gegenteil verkünden können. Ich glaube, viele Punkte, die Duque in der Kampagne versprochen hat, wurden eben in der Kampagne versprochen. Wie viel er davon wirklich umsetzen will, wird sich erst in einigen Monaten zeigen. Ich denke, er wird abwarten. Die Gespräche mit der ELN in Havanna gehen gut voran, eine Einigung auf einen Waffenstillstand ist nicht mehr weit entfernt. Die ELN legt viel Wert auf einen Prozess, der die Zivilgesellschaft mit einbezieht – und hat in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie ein Interesse an der Fortführung der Gespräche hat. Und die Verhandlungen sind wichtig: Ein Abkommen mit der ELN ist das, was zum Frieden fehlt. Die Guerilla hat einige ehemalige Einflussgebiete der Farc übernommen und versucht dort, ihre Macht auszubauen. Solange diese Situation nicht geklärt ist, werden einige Teile Kolumbiens keinen Frieden erleben.
Wie erklären Sie sich die Polarisierung in der Bevölkerung insbesondere rund um das Friedensabkommen mit der Farc?
Es gibt fünf Punkte, die zentral sind. Erstens, ein Friedensprozess, der methodisch so angelegt war, dass er weit weg von Kolumbien stattfand und größtenteils geheim ablief. Der Prozess war daher oft sehr weit von der Realität in Kolumbien entfernt – und andersherum. Zweitens, ein sehr langer Konflikt mit entsetzlichen Auswirkungen auf die Menschenrechte. Die Farc sind wesentlich für diese Grausamkeiten verantwortlich. Wir reden von einem Land, in dem die Bevölkerung in den Städten den Konflikt am Fernseher erlebte und die Farc als Hauptkonfliktpartei identifizierte. Ein Kolumbien, das die Realität in dem anderen Kolumbien, in den Konfliktgebieten, nicht kannte und daher nur ein beschränktes Verständnis für den Konflikt als solchen entwickelte. Außerdem sind Fehler passiert: Die Farc haben zwar einige Opfergruppen besucht und ihre Verantwortung ihnen gegenüber anerkannt. Aber Kolumbien hat überzeugendere, eindrücklichere Nachrichten erwartet.
Viertens, das Thema Politik. Der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen begann im Grunde schon vor dem Referendum über den Friedensprozess. Und diese Kampagne war wesentlich für die Spaltung der Gesellschaft verantwortlich.
Außerdem glaube ich, dass sich in den vergangenen 53 Jahren viele Bilder in den Köpfen der Menschen entwickelt haben, die uns voneinander trennen. Die Reichen von den Armen, die Stadt von dem Land. Es ist eine Herausforderung, diese geteilten Welten wieder zu vereinen.
Wie bewerten Sie die Bedrohungen durch paramilitärische Gruppierungen und die Menschenrechtssituation auf dem Land, wo immer wieder Menschenrechtsaktivist*innen ermordet werden?
Der dritte Punkt im Friedensabkommen spricht von den Garantien für die Ausübung der Politik und der Verteidigung der Menschenrechte. Im vergangenen Jahr wurde ein Gesetz verabschiedet, das den Paramilitarismus für alle Zeiten in Kolumbien verbietet. Das war vor allem ein symbolischer Akt, der die Kontrolle des Staates bestätigt und die Ausübung von Gewalt durch Privatpersonen untersagt. Zusätzlich gibt es einige Mechanismen, die bereits in Betrieb sind. Spezialeinheiten bei Staatsanwaltschaft und Polizei haben bereits deutliche Erfolge bei der Zerschlagung und strafrechtlichen Verfolgung dieser Strukturen erzielt – die sich statistisch belegen lassen. Eine Herausforderung ist der Drogenhandel, der den Konflikt befeuert und ausgelöscht werden muss. Der vierte Punkt des Friedensabkommens, der sich darauf bezieht, bedeutet eine wesentliche Änderung in unserem Kampf gegen Drogen: Wir wollen die Kokapflanzen durch legale Pflanzen ersetzen, was aber ein sehr langsamer Prozess gemeinsam mit den betroffenen Kleinbauern ist. Die Umsetzung und die damit verbundenen Garantien, etwa für Zugangswege und ökonomische Sicherheit, brauchen Zeit. Leider sind illegale Gruppen manchmal schneller und effizienter mit ihren Drohungen. Der Prozess muss daher an einen Punkt kommen, wo wir effizient sind in unserem Kampf gegen den Koka-Anbau und deutlich schneller voranschreiten.
Vor den Wahlen zeigten viele Organisationen der Opfer des Konfliktes sich besorgt über einen möglichen Wahlsieg Duques. Was sagen Sie diesen Opfern?
Dass sie die Hoffnung bewahren sollen. Der Staat wird immer der Staat sein und muss als solcher seine Verpflichtung als Garant der Menschenrechte erfüllen. Durch den Friedensprozess und nationale sowie internationale Abkommen sind wir an einem Punkt, wo der Staat bestimmte Rechte – etwa auf die Wahrheit, Gerechtigkeit, Reparation und Nicht-Wiederholung – garantieren muss. In Institutionen, die mit der Umsetzung des Friedensprozesses betraut sind, gibt es einen großen Willen, eine gute Arbeit zu leisten. Außerdem können wir auf eine Vielzahl von Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen vertrauen, die darauf achten, dass die Regierung ihre Aufgaben erfüllt.

 Ihre Wähler*innen, viele davon enttäuscht von den früheren Mitte-Links-Regierungen, setzen nun große Hoffnungen in den Frente Amplio. Einige der neuen Abgeordneten des Bündnisses sind jedoch bereits frustriert, weil der Gesetzgebungsprozeß in Chile sehr langsam ist. Läuft der FA Gefahr, die geweckten Erwartungen zu enttäuschen?
Ihre Wähler*innen, viele davon enttäuscht von den früheren Mitte-Links-Regierungen, setzen nun große Hoffnungen in den Frente Amplio. Einige der neuen Abgeordneten des Bündnisses sind jedoch bereits frustriert, weil der Gesetzgebungsprozeß in Chile sehr langsam ist. Läuft der FA Gefahr, die geweckten Erwartungen zu enttäuschen? Was macht Antena Negra aus?
Was macht Antena Negra aus?