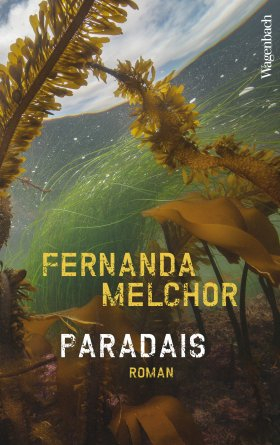“Gerechtigkeit” Die Gesichter der Opfer von Menschenrechtsverletzungen an einer Hauswand in Santiago (Foto: Ute Löhning)
Eine Folge der Repression gegen die sozialen Proteste in Chile seit Oktober 2019 waren Tote und Verletzte, viele Menschen erlitten Augenverletzungen, es gibt Berichte über Folter durch Polizeikräfte. Wie haben Sie bei CODEPU diese Zeit erlebt?
Die Menschen kannten CODEPU noch aus Zeiten der Diktatur, als wir, wie auch die Vicaría de la Solidaridad, uns der zahlreichen Menschenrechtsverletzungen annahmen. Nach dem Beginn der Revolte 2019 kamen sofort zahllose von Polizeiübergriffen Betroffene zu uns. Wir besuchten Festgenommene in Polizeidienststellen und Verletzte in den Krankenhäusern. Wir begannen die Informationen zu systematisieren und errichteten eine eigene – informelle – Gesundheitsstation, in der wir Verletzte betreuten und an Krankenhäuser weiterleiteten. Diese Arbeit führen wir bis heute fort. Wir haben bislang etwa 200 Strafanzeigen wegen Menschenrechtsverletzungen gestellt. Und wir vertreten etwa 60 Menschen anwaltlich, die während der Proteste verhaftet wurden.
Wie verlaufen die Strafverfahren wegen Menschenrechtsverletzungen, die von Angehörigen der staatliche Sicherheitskräfte begangen wurden? Gibt es Verurteilungen?
Seit dem 19. Oktober 2019 wurden tausende Strafanzeigen gestellt. Bislang gibt es erst vier verurteilte Polizisten. Eine dieser Verurteilungen – wegen Folter an einem Demonstranten aus Lo Hermida – haben wir erreicht. Doch die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Wir stellen leider fest, dass die Staatsanwaltschaft mit zweierlei Maß misst: Bei Vorwürfen gegen Protestierende wird schnell und eingehend ermittelt, es gab zahlreiche Verurteilungen und viele Beschuldigte sitzen über lange Zeit in Untersuchungshaft.
Bei Ermittlungen gegen Angehörige der staatlichen Sicherheitskräfte ziehen sich dagegen die Verfahren in die Länge, etwa 40 Prozent der Untersuchungen wurden eingestellt. Staatliche Stellen, die diese Verfahren unterstützen sollten, wie das gerichtsmedizinische Institut SML, wurden personell nicht aufgestockt und sind überfordert. So werden beispielsweise bei Foltervorwürfen notwendige forensische Gutachten verzögert. Das erschwert die Beweis-*führung, führt zu Frustration bei den Betroffenen und einem Glaubwürdigkeitsverlust des Justizsystems.
Sitzen mutmaßliche Täter*innen aus den Reihen der Polizei in Untersuchungshaft?
Einige Wenige. Beispielsweise führen wir Nebenklage im Fall eines am 23. Oktober 2019 in Buin verhafteten Demonstranten, Mario Acuña. Er wurde nach seiner Festnahme von sechs Polizisten schwer verletzt und gefoltert. Seit März dieses Jahres befinden sich nun drei Beschuldigte in Untersuchungshaft. Das ist ein großer Erfolg, denn wir beobachten, dass in vielen sehr bekannten Fällen, wie Gustavo Gatica oder Fabiola Campillay, die ihr Augenlicht verloren haben, die Beschuldigten unter Auflagen auf freiem Fuß sind. Wir hoffen, dass im Fall von Mario Acuña bei der anstehenden Haftprüfung die Untersuchungshaft der Beschuldigten aufrecht erhalten wird. Sie sind eine Gefahr für die Gesellschaft, sie haben im Verfahren nachweislich gelogen und die Ermittlungen behindert. Im Moment sind sie zumindest vom Polizeidienst suspendiert.
Wie viele der verhafteten Demonstrant*innen sitzen derzeit in Untersuchungshaft?
Es gab bis vor einiger Zeit um die 2500 politische Gefangene. Die Anzahl ist nun zurückgegangen, gegenwärtig sitzen noch etwa 70 politische Gefangene in Untersuchungshaft. Von den Gefangenen, die CODEPU vertritt, sind im Moment noch zwei inhaftiert. Wir haben vielfach eine Aufhebung der Untersuchungshaft beantragt. Doch obwohl keinerlei Beweise gegen sie vorliegen, sitzen sie weiterhin im Gefängnis. Das sind keine Einzelfälle: Viele Beschuldigte werden trotz fehlender Beweise nicht aus der Untersuchungshaft entlassen.
Auf politischer Ebene wird derzeit über ein Amnestiegesetz für die politischen Gefangenen debattiert. Wie steht CODEPU dazu?
Wir unterstützen die Forderungen nach einer Amnestie. In einer Stellungnahme haben wir den verfassungsgebenden Konvent dazu aufgefordert, die Problematik der politischen Gefangenschaft zu behandeln. Das Parlament hat eine Abstimmung über den Gesetzesentwurf für eine Amnestie bislang immer wieder verzögert. Formell handelt es sich bei dem Gesetzesentwurf um eine Begnadigung. Es sollen jedoch sowohl bereits Verurteilte wie auch Beschuldigte einbezogen werden, es handelt sich also letztlich um eine Amnestie. Vor einigen Tagen haben Angehörige der politischen Gefangenen einen Hungerstreik begonnen, der so lange aufrechterhalten werden soll, bis das Parlament darüber abstimmt. Ursprünglich gab es weitreichende Unterstützung im Parlament. Jetzt sieht es so aus, als würde eine Abstimmung bis nach den Wahlen hinausgezögert, das wäre kein gutes Zeichen.
Was bedeutet das für die politischen Gefangenen?
Die Gefangenen leiden körperlich und psychisch unter den schlechten Haftbedingungen, die internationalen Standards zuwiderlaufen. Es ist ein Wunder, dass es unter diesen Umständen noch zu keinen Corona-Erkrankungen unter ihnen kam. Viele der Gefängnisse in Chile werden von privaten Unternehmen verwaltet, die Mindeststandards nicht einhalten. Wir haben beim Rechnungshof eine Beschwerde eingereicht, damit der Staat regulierend eingreift und menschenwürdige Haftbedingungen garantiert.
Im vergangenen Juli waren Sie als Vertreterin von CODEPU Teil der internationalen Beobachtungsmission SOS Colombia, die während der sozialen Proteste in Kolumbien begangenen Menschenrechtsverletzungen dokumentiert und darüber einen Bericht verfasst hat. Wie waren Ihre Erfahrungen in Kolumbien?
Vor SOS Colombia haben andere Beobachter*innen Kolumbien besucht: Eine Delegation der Interamerikanischen Menschenrechtskommission (CIDH) sowie eine argentinische und eine katalanische Delegation. Sie besuchten einzelne Regionen und waren nur wenige Tage im Land. Unsere Delegation bestand aus 41 Mitgliedern aus 14 Ländern und war vom 3. bis 23. Juli in elf Regionen Kolumbiens unterwegs. Dort konnten wir an geschützten Orten etwa 180 Zeug*innen befragen.
Während der drei bis vier vorangegangenen Monate waren etwa 7.000 Menschen Opfer von Menschenrechtsverletzungen geworden. 8.500 wurden festgenommen, mehr als 800 Menschen sind verschwunden oder ihr Aufenthaltsort war zeitweilig nicht bekannt. Wenn dieses Ausmaß an Staatsterrorismus anhält, kann das zu hunderttausenden von Opfern führen.
Sowohl in Kolumbien als auch in Chile wurden die Proteste von staatlicher Seite als „Krieg“ bezeichnet und von internen Feinden gesprochen. Welche Unterschiede und Parallelen gibt es bei der Repression gegen die sozialen Proteste in beiden Ländern?
Bei den Menschenrechtsverletzungen in Chile und Kolumbien gibt es ähnliche Verhaltensmuster der Sicherheitskräfte. Es ist beispielsweise kein Zufall, dass es in Kolumbien, Chile und auch in Ecuador zahlreiche Augenverletzungen gab. In Chile gab es in den beiden vergangen Jahren 500 Opfer von Augenverletzungen. In Kolumbien waren es in drei Monaten bereits 114 Opfer. Auch in Ecuador wurden während der sozialen Proteste mehr als 80 Menschen an den Augen verletzt.
Ich denke, es gibt eine Politik des Staatsterrorismus, die darauf abzielt, die Demonstrierenden zu bestrafen, um die Proteste einzudämmen. In Zeiten der Diktatur sollten die Proteste ganz unterbunden werden. Heute geht es darum, die Zahl der Protestierenden zu verringern, indem ihnen Schmerzen zugefügt werden, indem sie verängstigt werden. Durch jede*n verletzte*n Demonstrierende*n wird Angst geschürt und weniger Menschen beteiligen sich am Protest.
Gibt es auch strukturelle Gemeinsamkeiten?
Chile und Kolumbien erhalten ihre Waffen von denselben Firmen und es sind Sicherheitskräfte aus diesen beiden Ländern, die Schulungen für Polizeikräfte in der gesamten Region durchführen. In beiden Ländern gab es bisher keine Polizeireform. In Chile agiert heute dieselbe Polizei wie zu Zeiten der Pinochet-Diktatur. Die ESMAD (Aufstandsbekämpfungseinheit der kolumbianischen Polizei, Anm. der Red.) wird auf der Grundlage eines Diskurses des „inneren Feindes“ für die Aufstandsbekämpfung instruiert.
Beide Organisationen werden nicht dafür ausgebildet, friedliche soziale Proteste zu begleiten. Ich denke, der Ursprung dieser Haltung liegt in der Escuela de las Américas (Schulungszentrum der USA für lateinamerikanische Polizeikräfte während der lateinamerikanischen Diktaturen, Anm. d. Red.) und dass diese Kooperation in den 1990er Jahren vertieft wurde.
Waren an den Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien und Chile extralegale Gruppen beteiligt, wie Paramilitärs oder andere bewaffnete Einheiten?
Ja, es gibt neben der Nationalpolizei und der ESMAD eine Reihe weiterer extralegaler Gruppen, die in Koordination mit Mitgliedern der Polizei Aktivist*innen einschüchtern und bedrohen. Das gibt es auch in Chile, zum Beispiel die paramilitärische Gruppe APRA, eine faschistische Gruppe, die vor allem in Wallmapu – den Mapuche-Territorien – aktiv ist. Die Aktivitäten solcher Gruppen haben sich dem Beginn der Revolte verstärkt, sie versuchen, Selbstjustiz zu üben, bleiben meist straflos und werden von Polizeikreisen gedeckt.
In Kolumbien sind solche extralegalen Gruppen noch weiter verbreitet. Letztlich agiert die Regierung dort gegen die Bürger*innen und die Institutionen funktionieren schlechter als in Chile. Beispielsweise gibt es in Kolumbien im Bezug auf gewaltsames Verschwindenlassen ein Warn- und Suchsystem. Dieses hat jedoch während der Proteste bei mehr als 800 Fällen von Verschwundenen vollständig versagt. Auch die Staatsanwaltschaften wurden nicht aktiv. Was die Institutionen angeht, sind wir in Chile einen Schritt weiter.
Es heißt, dass sich viele neue soziale Akteur*innen an den Protesten beteiligen. Welche Menschen gehen in Chile und Kolumbien auf die Straße?
Es gibt eine Reihe von neuen sozialen Akteur*innen in diesen Protestbewegungen, die nicht alle gleichermaßen von staatlicher Gewalt betroffen sind. Zu den wichtigsten Akteur*innen zählen in beiden Ländern die Aktivist*innen der primera línea, die besonderer Gewalt und Verfolgung ausgesetzt waren und sind. Unter den Opfern von Menschenrechtsverletzungen in beiden Ländern gab es viele Schüler*innen und Studierende, auch viele politisierte Fußballfans. Die Repression richtete sich gegen queere Menschen, gegen Migrant*innen, gegen medizinische Versorgungsposten auf den Demonstrationen. Besonders stigmatisiert und kriminalisiert wurden auch unabhängige Journalist*innen, die Übergriffe dokumentierten. Ihre Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen war oft nützlich für Strafanzeigen und Ermittlungen. Hier in Chile gab es fünf Fotograf*innen beziehungsweise Kamaraleute, die ein Auge verloren haben.
Der Abschlussbericht von SOS Colombia enthält eine Reihe von Empfehlungen. Welche würden Sie hervorheben?
Zu den besonders dringlichen Empfehlungen gehört die Demilitarisierung der Polizei. Sie sollte nicht mehr dem Verteidigungsministerium unterstehen. Außerdem sollten reale Verhandlungen zwischen dem kolumbianischen Staat und den an den Protesten beteiligten Gruppen geführt werden. Es gab bislang etwa elf Dialogrunden, die ergebnislos beendet wurden. Ebenfalls dringlich sind ein besserer Zugang zur Justiz, eine umfassende Entschädigung der Opfer sowie Garantien, dass sich das Vorgehen nicht wiederholt. Es sollte eine Untersuchungskommission zur Straflosigkeit von Akteur*innen, die Menschenrechtsverletzungen begangen haben, gegründet werden. Ausländische Investor*innen sollten zur Bedingung machen, dass die staatliche Gewalt endet und die Arbeitsgesetze eingehalten werden. Und als internationale Gemeinschaft sollten wir die Menschenrechtsverletzungen sichtbar machen, um Druck auf die kolumbianische Regierung auszuüben.