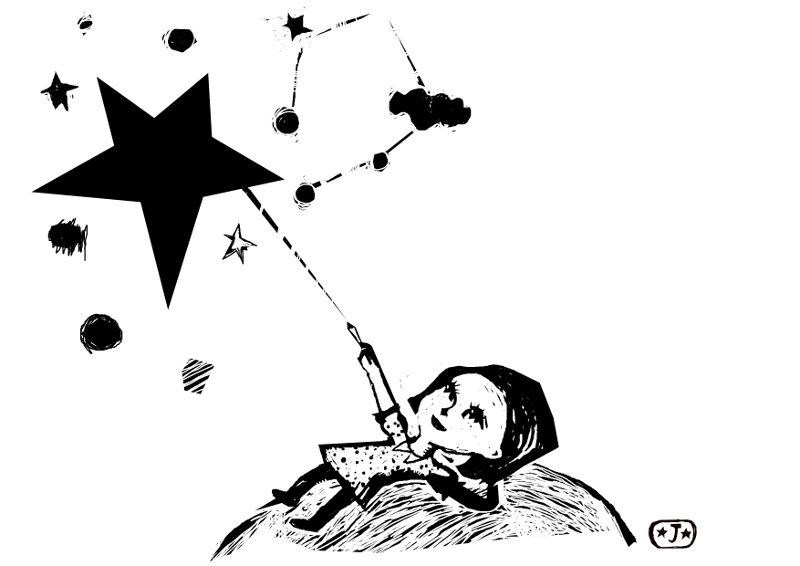Würde für Minenarbeiter – Forderungen nach Gerechtigkeit und der Bergung der Opfer werden seit Jahren gestellt // Foto: Toño Hernández (CC BY-NC 2.0)
Würde für Minenarbeiter – Forderungen nach Gerechtigkeit und der Bergung der Opfer werden seit Jahren gestellt // Foto: Toño Hernández (CC BY-NC 2.0)
Wie sind Sie dazu gekommen, im Bereich der Kohleminen zu arbeiten?
Seit 1997 verteidige ich die Arbeitsrechte von Minenarbeitern. In den ersten Jahren habe ich für eine kirchliche Organisation gearbeitet, die aus der Tradition der Befreiungstheologie heraus agierte. Damals kämpften wir dafür, dass Arbeitsrechte weltweit als Menschenrechte angesehen würden. Als am 19. Februar 2006 die Kohlemine von Pasta de Conchos in Coahuila explodierte, wurden wir dorthin berufen. Uns wurde gesagt, dass ein Unfall passiert sei, Entschädigungen fällig würden und die sterblichen Überreste der Minenarbeiter an die Angehörigen der Opfer übergeben werden müssten. Schnell wurde uns klar, dass es kein Unfall gewesen war. Ziel war es nun, die Verantwortlichen für die Arbeitsverhältnisse und den Zustand der Mine zu bestrafen. Am 25. Februar veröffentlichten wir einen Bericht, in dem wir das Unternehmen anklagten, nicht die nötigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen zu haben, um das Unglück zu verhindern.
Was passierte nach dem Unglück mit der Mine?
Pasta de Conchos wurde im Jahr 2007 geschlossen und die Rettungsarbeiten für die übrigen 63 verschütteten Minenarbeiter wurden abgebrochen. Laut Angaben des Unternehmens, das dabei vom Staat Rückendeckung erhielt, befand sich kontaminiertes Wasser in der Mine und es wurde behauptet, die Rettungskräfte würden sich dadurch mit Hepatitis, Tuberkulose, HIV und ähnlichem anstecken. Das Unternehmen muss von den Gesundheitszuständen der sich in der Mine befindenden Personen gewusst haben. Wenn diese krank gewesen wären, hätten sie sie gar nicht erst in die Mine lassen dürfen. Aber so ist es immer: Sie waschen sich die Hände rein und Schuld sind die Toten. Ich konnte damals nicht glauben, dass sie die Rettungsarbeiten wirklich abgebrochen hatten, aber noch weniger, dass der Staat die Gründe dafür als legitim erachtet hat
Welche waren Ihrer Meinung nach die wahren Gründe dafür, dass die Rettungsarbeiten abgebrochen wurden?
Rückblickend sind mir zwei Dinge aufgefallen. Erstens: 2006 öffnete sich der Kohlebergbau gegenüber ausländischen Investitionen, besonders aus Kanada. Der Staat hatte also kein Interesse daran, ein Bergbauunternehmen zu bestrafen. Bei uns denken die Regierenden, dass Gerechtigkeit die Investoren verschreckt. Zweitens: Der Fall von Pasta de Conchos ist der erste in der Geschichte des mexikanischen Kohlebergbaus, in dem die Forderung nach Bestrafung der Verantwortlichen laut geworden ist. Bis dato waren in den Kohleminen Coahuilas seit dem Jahr 1900 schon etwa 3.000 Arbeiter gestorben und niemals hatte jemand die Gründe dafür hinterfragt oder Gerechtigkeit gefordert. Wenn Grupo México also die sterblichen Überreste an die Hinterbliebenen übergeben hätte, hätte das Unternehmen seine Verantwortlichkeit akzeptiert. Mit diesem Druck konfrontiert, haben sie sich dagegen entschieden und die Angehörigen sich selbst überlassen. Die Minenarbeiter, die ursprünglich mit der Bergung beauftragt worden waren, fühlen sich bis heute schuldig, die Frustration und die Wut hält auch bei ihnen an. Seit dem Gutachten der Interamerikanischen Menschenrechtskommission gibt es Aufschwung in der Region, die dort ansässigen Minenarbeiter wollen die Körper unbedingt bergen.
Was genau besagt das Gutachten der CIDH?
Die CIDH hat den Fall von Pasta de Conchos angenommen und festgestellt, dass nicht nur die Rechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit der Minenarbeiter und juristischen Schutz der Familien verletzt wurden, sondern auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Das Gutachten der Kommission bezieht sich sowohl auf die Kohleminenarbeiter, als auch auf die Gesamtheit der Minenarbeiter in Mexiko. Ich glaube, dass nun wichtige Fortschritte gemacht werden. Die neu entstandene Möglichkeit der Bergung in Pasta de Conchos wird hoffentlich dafür sorgen, dass die ganze Welt auf Coahuila schauen wird und darauf, was Mexiko, aber auch Kanada und die extraktivistischen Unternehmen im Bergbau anstellen.
Bis heute wurde niemand für das Unglück in Pasta de Conchos bestraft?
Nein. Auch dann, wenn wir auf Kinderarbeit und Arbeiter ohne Versicherung hinweisen, wird niemand bestraft. Die Unternehmen sagen zu mir: „Du kannst strampeln so viel du willst, ich bezahle 170.000 Pesos und mache weiter wie bisher.“ Soviel kostet ein toter Minenarbeiter. Sie glauben, dass es damit behoben ist. Es überrascht mich, dass immer wieder ermittelt wird, doch die Verfahren abgebrochen werden, bevor ein Urteil gefällt wird. Als Unternehmen kannst du sagen: „Hier ist die Reparationszahlung. 170.000 Pesos.“
Und das Geld bekommen die Familien?
“Das Geld wird den Richtern in Coahuila übergeben, die den Fall dann ohne Urteil schließen. Es ist keine echte Straftat, Minenarbeiter zu töten. Es wird als ein Unfall angesehen, ohne Vorsatz. Sie zahlen also für ein versehentliches Tötungsdelikt. Die Akte wird geschlossen, dem Unternehmen wird vergeben und die Lizenz können sie behalten. Nur wenn wir einen großen Skandal daraus machen, passiert etwas. Wenn es nur um eine tote Person geht, passiert gar nichts. Das gehört zu den perversesten Dingen auf dieser Welt.”
Wie wurde die Organisation Familia Pasta de Conchos gegründet, in der Sie heute arbeiten?
Die Organisation hat sich ganz organisch und selbstständig entwickelt. Im Jahr der Tragödie bemerkten wir, dass der Staat nur die Witwen und Waisen als Opfer der Verschütteten akzeptierte, nicht jedoch die Eltern oder Geschwister. Wir gingen also in die Familien hinein und zählten die direkten Angehörigen. Am Anfang hatten wir eine Liste von 350 Personen und begannen, von der Familie Pasta de Conchos zu sprechen, in der alle Betroffenen einbezogen wurden. Da auch in anderen Minen immer wieder Personen starben, wurden wir zu einer Organisation, die sich auch um andere Fälle kümmerte.
Welche Minen stehen heute im Fokus und wie geht die Organisation vor?
Ich denke, dass alle Minen im Fokus stehen. Die Leute der Organisation sind überall vor Ort. Wir benutzen ein gut funktionierendes Notfallprotokoll, aber vor allem arbeiten wir an der Prävention. Das ist der große Beitrag der Organisation in der Bergbauregion. Wir benachrichtigen die Familien und die Bergbauarbeiter, wenn wir glauben, dass an einer bestimmten Stelle ein Risiko besteht, das tödliche Folgen haben kann. Seit 2013 haben sich so die Todesfälle um 97 Prozent verringert.
Sie werden unter anderem von pbi in Ihrer Arbeit geschützt. Was bedeutet das für Sie?
Ich werde seit Juni 2007 durch Vorsichtsmaßnahmen geschützt, also schon seit einem Zeitpunkt, als der Mechanismus zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und Journalisten der Regierung, von dem ich heute auch Teil bin, noch gar nicht existiert hat. Möglicherweise gehöre ich zu den Menschenrechtsverteidigerinnen, die am längsten geschützt werden. Dieser Mechanismus, der unter anderem von der EU finanziert wird, erscheint mir allerdings wenig sinnvoll, weil sie nicht aufpassen. Ich konnte beweisen, wer alles Kampagnen gegen mich fährt und mich bedroht, aber es ist nichts passiert. Ich finde es absurd, dass der Staat mit einem Arm den Kohlebergbau fördert und mit dem anderen Vorsichtsmaßnahmen trifft, die den Menschenrechtsverteidigern helfen sollen, die wiederum von den Entscheidungen des selben Staates in Bezug auf den Bergbau betroffen sind. Pbi begleitet mich schon seit 2014. Das war das Jahr, in dem wir herausfanden, dass viele der Unternehmer im Kohlebergbau Politiker der damaligen Regierungspartei PRI waren. Ich kann sagen, dass ich dank pbi noch am Leben bin. Die Unternehmen und Politiker fühlen sich von einer internationalen Instanz beobachtet, die niemals Teil von ihnen sein wird.
Sie sind bis heute am Unglücksort von Pasta de Conchos geblieben. Warum?
Es ist ein hässlicher Ort. Als ich ankam, sagte ich zu mir selbst: Nicht im Traum werde ich hier leben. Nun lebe ich seit neun Jahren dort. Jetzt gefällt es mir sehr gut, vor allem wegen der Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Kohleminenarbeiter haben die Fähigkeit, jeden Moment zu genießen, weil sie nicht wissen, ob sie morgen sterben werden.
Viele Frauen im Bereich des Bergbaus agieren als Witwen von verstorbenen Minenarbeitern. Gibt es auch Frauen, die in den Minen arbeiten?
Nein, außer mir kommen keine Frauen in die Minen hinein. Diese Arbeit war schon früher Männersache und ist es auch heute noch. Der Kohlebergbau ist ein unglaublich machistisches Metier, denn das Risiko selbst ist mit klassisch männlichen Attributen verbunden. Für viele Männer ist es sehr schwierig zu sagen, dass sie nicht in die Mine wollen, weil sie Angst haben. Heute ist es so, dass nicht nur die Witwen, sondern auch die Frauen und Töchter von Minenarbeitern über die Sicherheit in den Minen sprechen. Wenn sie beispielsweise sehen wie der Vater, der keine Versicherung besitzt, verletzt aus der Mine kommt, schicken sie mir eine Nachricht. Frauen haben begonnen, sich technisches Wissen anzueignen, um festzustellen, ob eine Mine ein Sicherheitsrisiko darstellt. Dies setzt den Sektor enorm unter Druck. Mittlerweile ist es normal, dass auch die Minenarbeiter untereinander und mit ihren Familien über das Thema Sicherheit sprechen. Sie haben verstanden, dass sie so oder so in der Mine arbeiten werden, aber dass sie Druck ausüben können, um ihre Konditionen zu verbessern.